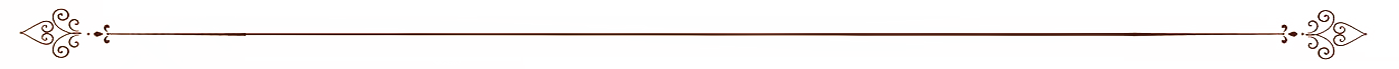Ich will in diesem Artikel gar nicht so sehr auf den Inhalt der Schillerschen Werke eingehen. Es ist, wie ich das bisher wahrgenommen habe, immer sehr ähnlich. Sein grundlegendes Motiv lautet: Der Mensch von Seelengröße steht durch sein vornehmes Verhalten in seinem Seelenadel höher noch als weltliche Adelige, die des Seelenadels ermangeln. Adel und, grundlegender, auch die Menschenwürde hat man sich durch entsprechend würdiges Verhalten zu verdienen. Das ist der Aristokratengeist, den seine Dramen atmen.
Ein Motiv, das mir schon für sich gefällt, doch kann man auch an der Dramaturgie festmachen, warum die Dramendichtung mit Schiller ihren Höhepunkt gefunden hat. Und erst im Zusammenspiel dieser zwei Elemente wird Schiller zum vielleicht größten Poeten der Menschheitsgeschichte.
Die Wiederentdeckung des Dramas
Während das orale Mittelalter eine Zeit der Ritterlieder und Heldenepen darstellt, von deren vermutlich vielen verschiedenen mündlichen Fassungen nur einige schriftlich auf uns gekommen sind, war es keine große Zeit des Dramenspiels. An schriftlich fixierte Tragödien mit komplexen szeneastischen Dynamiken, zu deren Aufführung man eine ganze Schauspieltruppe benötigte, hat zu dieser Zeit niemand gedacht. Auch war die Umsetzbarkeit ein großes Problem. Das mußte neu erfunden oder besser wieder entdeckt werden. Mit der Renaissance und dem Aufziehen der Frühen Neuzeit aus dem Spätmittelalter heraus, gewann das Drama mit der Neuentdeckung antiker Werke wie der der Griechen Euripides, Sophokles oder Aischylos und den literaturwissenschaftlichen Schriften von Aristoteles erneut an Bedeutung.
Es wurden neue Dramen geschrieben, antike historische oder biblische Stoffe adaptiert, man machte sich Gedanken über die Wirkung auf das Publikum und die erzieherischen und didaktischen Möglichkeiten, die das Theaterspiel und das öffentliche Aufführen boten – so zum Beispiel im Jesuiten- und Schultheater – und investierte bereits zu dieser Zeit großen Aufwand in Bühnenbilder, Effekte, Kostüme und darstellerische Komposition um das Publikum in Erstaunen zu versetzen. Auf dem Kontinent wurden Regalmeter an neuen Stücken geschrieben, die aber selten groß publiziert und nur zu spezifischen Anlässen als öffentliches Massenereignis aufgeführt wurden, weshalb vieles davon heute kaum bekannt oder längst vergessen ist.
Die Anfänge eines autorengetriebenen Programmtheaters im modernen Sinne – eine feste, professionelle Schauspieltruppe, regelmäßige Spielzeiten, spezifisch dafür vorgesehene Aufführungsgebäude, ein Kanon an Stücken – finden wir aber praktisch erst wieder bei Shakespeare, genauer: im Elisabethanischen Zeitalter. Hier wurde erstmals seit der Antike die Tradition der Dramatik als professionelles Handwerk wieder aufgenommen und Shakespeares Stücke erreichten dank der Innovativität ihrer Darbietung, ihrer literarischen Qualität und umfangreicher Reproduktion und Publikation überzeitliche internationale Bekanntheit und Anerkennung.
Ein Meister mit Makel?
Und ich finde, das merkt man auch, wenn man Shakespeare liest. Der Genius dieses Dichters hat es ihm erlaubt, aus dem Stand Weltliteratur zu erschaffen. Psychologisches Feingefühl sowie unglaubliche Sprachgewandtheit waren ihm in die Wiege gelegt, und haben sich in seinem literarischen Schaffen deutlich niederschlagen. Das mußte er nicht lernen – das hatte er. Und deshalb ist er in dieser Disziplin möglicherweise bis heute unübertroffen. Doch vor allem in der Dramaturgie selbst fällt der Mangel an Erfahrung auf: Die Dramen wirken schwerfällig und die Handlung ist so vorhersehbar, daß man nach drei verschiedenen Lektüren getrost vorhersagen kann, wie die anderen ausgehen: Der tragische Tod kommt ganz sicher.
Genauso steif sind auch Shakespeares Sonette. Erneut strotzen sie vor Kreativität und Wortgewalt, auf die man nur neidisch sein kann. Doch mahnen sie immerhin ein wenig an ein rein abstraktes Jonglieren mit Worten. Das ist natürlich der Form geschuldet: Im Sonett ist alles festgelegt, von der Verszahl, über das Reimschema, bis hin zur Anzahl der Hebungen pro Vers. Lyrisch vermutlich eine der herausforderndsten Arten der Dichtung – und man muß mal festhalten: Er hat 154 davon geschrieben! –, bedürfen sie einer enormen Sprachbeherrschung – und bedienen damit automatisch mehr den kognitiven als den emotionalen Teil des Menschen. Shakespeares Sonette sind nicht frei von der Brust weg wie Goethes Sesenheimer Lieder, sondern in ein strenges Korsett gepreßt, und deshalb wirken sie auf mein Herz weniger tief als Goethe.
Bereits bei Shakespeare begann die Entwicklung
Wenn man von einigen Stücken absieht, wie etwa König Lear, Macbeth, oder Coriolan (zu dem es eine ganz hervorragende Interpretation des Schattenmachers gibt), hat mich kaum ein Shakespearesches Drama emotional gepackt. Hamlet, Othello, Romeo und Julia – sie fühlen sich für mich irgendwie gleich an. Am Ende sind alle tot. Gerade bei Hamlet ist das einfach zu viel des Guten. Wann in der Menschheitsgeschichte endete der Streit zweier Parteien damit, daß am Ende gemäß Wortsinn alle tot waren?
Bei Romeo und Julia tötet sich erst Romeo über der totgeglaubten Julia selbst, und als diese aufwacht, begeht auch sie Selbstmord. Ist es realistisch, sich über dem Geliebten sofort selbst umzubringen? Verfiele man nicht erst in Trauer oder Verzweiflung? In Leugnung und Nicht-wahr-haben-wollen? Oder wartet man verzweifelt darauf, daß jener doch noch zu sich kommt? Und obwohl sich Shakespeare dessen sicher bewußt war, ereignet sich aus dramaturgischen Gründen, die den Tod erzwingen, die unwahrscheinlichste Option gleich zweimal hintereinander: der Selbstmord. Das ist zu tragisch (und vor allem zu unrealistisch), um es noch nachempfinden zu können. Es wirkt gekünstelt und gezwungen, und löst derowegen bei mir kein Mitgefühl aus.
Anscheinend ist das sogar Shakespeare aufgefallen, denn ich finde, man kann von Titus Andronicus, den man grob auf 1590 datiert, bis zu seiner letzten großen Tragödie, Macbeth, datiert auf 1605/1606, eine deutliche Steigerung erkennen: In Macbeth wird nicht nur die damals in England übliche Bühnenform der Apron Stage meisterhaft ausgereizt; auch ist das Drama sehr viel straffer und übersichtlicher als die wild mäandernden älteren Dramen. Es gibt eine strenge Rahmenhandlung und den roten Faden eines philosophischen Motivs, das dem Drama zugrunde liegt.
Der Höhepunkt in Weimar
Diese Thematik kristallisierte sich sukzessive als Schwerpunkt des Dramas heraus: Nicht länger Tragik als moralischer Selbstzweck, sondern Tragik zur emotionalen Verstärkung jener weltanschaulichen Dynamiken, die das Drama antreiben. Schiller geht schließlich so weit, seine Tragödien einem zentralen Leitgedanken zu unterwerfen. Nicht länger will er durch „Jammer und Schauder“ den Leser läutern, sondern setzt auf die verstandesmäßige Erziehung des Menschen, derer nach seiner Auffassung zumindest theoretisch ein jeder empfänglich sein sollte. Die äußere Form ist bündiger, übersichtlicher und vor allem zielgerichteter: Eine klare Botschaft will vermittelt werden, für deren Verkündigung das Drama überhaupt erst geschrieben wurde. Dieser Perspektivenwechsel ermöglichte erst, was die Weimarer Dichterfürsten zu Papier brachten – Goethes Faust entspricht schließlich derselben Natur.
Die 200 Jahre von Shakespeare zu Weimar schlagen sich auch in der Sprache deutlich nieder: Während Shakespeare durch originelle Formulierungen, kreative sprachliche Wendungen und eine Wortgewalt begeistert, die einem rhetorischen Blitzgewitter gleichkommt, ist Schiller sehr viel näher an einer natürlichen Sprache. Sie ist geradlinig und schlicht, wie aus dem echten Leben. Und das gilt auch für die äußere Form: Schillers Dramen sind übersichtlich und elegant.
Schiller greift nicht plump immer zu Selbstmord, um die Tragödie zu einem Ende zu führen. Nein, der Tod seiner Figuren ist zumeist durch einen externen Faktor verschuldet. Maria Stuart wird von ihrer Rivalin enthauptet; Karl Moor wird zum Mord an seiner geliebten Amalia genötigt; Don Karlos ist das Opfer politischer Intrigen. Keiner von ihnen setzte seinem Leben freiwillig ein Ende. Im Gegenteil ist ihr Ende das notwendige Finale der gesamten Handlung: Darauf laufen alle Stränge zu. Deswegen ist die Handlung bei Schiller bedeutend reiner als bei Shakespeare, dessen Finale gerne ein plötzliches Deus ex machima ist – jetzt ist er halt im letzten Akt und muß das Drama irgendwie beenden. Und dazu bedient er sich des Selbstmordes. Nur glaube ich nicht, daß mehr als ein paar ganz wenige Ausnahmeindividuen tatsächlich so tief fühlen können, sich in ihr Schwert zu stürzen.
Musterbeispiel: Kabale und Liebe
In „Kabale und Liebe“ greift tatsächlich auch Schiller einmal zum Selbstmord. Doch nicht durch blutiges Sich-Selbst-Erdolchen: Ferdinand bedient sich eines Giftes. Nicht nur ist es nachvollziehbar, daß er Luise, von der er in diesem Moment annimmt, sie hätte ihn schmählich betrogen, ausgenutzt und kalt berechnend mit seinen Gefühlen gespielt, um die Ecke bringen will, um anschließend auf dieselbe Art sein eigenes Leid zu beenden. – Gift zu trinken bedarf bedeutend weniger Überwindung als sich einen Dolch in die Brust zu rammen. Ein Schluck vergiftete Limonade – man muß nur tun, was man sein Leben lang schon getan hat. Zumindest dürften nicht viele herumlaufen, die im Leben noch nie etwas getrunken haben.
Und dann der Präsident und sein Sekretär Wurm, die für alles verantwortlich sind. Ihre Taten werden aufgedeckt, und wie reagieren sie? Wurm, von Grund auf schlecht, lacht höhnisch, er würde den Präsidenten mit aufs Blutgericht zerren.
Der Präsident, in dem sich nun das Gewissen regt, fällt seinem sterbenden Sohn vor die Füße und fleht ihn um Vergebung an. Und wie erleichtert er ist, als ihm diese gewährt wird! „Er vergab mir! Jetzt [bin ich] euer Gefangener!“ ruft er aus, bevor er sich bereitwillig abführen läßt.
Damit endet das Drama; was aus den beiden Schurken wird, bleibt offen. Doch dieser dräuende Nebel ist viel subtiler, als wenn man die beiden noch an Ort und Stelle niedergeschlagen hätte.
Ja, ich glaube, bei Shakespeare hätten sich Wurm und der Präsident noch gegenseitig erschlagen, um die Sache rund zu machen. Und damit einfach zu dick aufgetragen. Das von Schiller gewählte Ende ist reiner, eleganter und wirkt deshalb wesentlich stärker auf das Gemüt. Kein Kitsch verhunzt die tragische, aus einem Mißverständnis erwachsene Selbsttötung des Liebespaars und läßt den Leser in echter Anteilnahme zurück.
Lose Enden sind nicht unbedingt offene Fragen
Dies zeigt sich auch im Schicksal der Lady Milford: Als diese für das Drama nicht länger benötigt wird, läßt Schiller sie nicht einfach Selbstmord begehen. Nein, es läßt sie ziehen. Sie kommt mit dem Leben davon, indem sie den Hof verläßt und sich ins Ausland absetzt. Das ist meiner Ansicht nach auch das realistischste. Was stört es des Dramas Tiefgang, daß hier ein loses Ende obwaltet?
Aus demselben Grund ist auch unerheblich, daß man nicht erfährt, was aus Luisens Mutter wird. Jene verschwindet einfach im Spinnhaus (=Gefängnis). Während der Vater entlassen wird, kehrt sie nicht zurück. Niemand weiß, wo sie verbleibt, ja, sie wird von niemandem auch nur ein weiteres mal erwähnt. Nicht einmal die Tochter frägt nach ihr. Doch ist das schlimm? Sie ist für das Drama nicht weiter von Relevanz; warum also sollte sich der Dichterfürst damit plagen, sie irgendwo am Bühnenrand herumtanzen zu lassen? Soll der Leser sie doch vergessen, das ist so gut wie alles andere.
Das wahre Leben spricht uns an
Mit solchen nach gängiger Dramentheorie ausgemachten Schlampereien verfeinert Schiller seine Werke. Seine Kunst ist keine rein abstrakte, sondern bildet das echte Leben ab – in einer idealisierten Form, versteht sich. Und doch ist seine Kunst, wie es wirklich sein könnte. Sie hält sich die Waage zwischen ästhetischer Form und realitätsnahem Anspruch. Während die Kunst gerade seit der 2ten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Ästhetik nun wirklich nichts mehr zu tun, war sie in den Jahrhunderten zuvor gekünstelt und steif.
Schiller rückte sie näher an die Realität; machte sie natürlicher – authentischer. Durch ein paar kleine Ungenauigkeiten; durch ein wenig künstlerische Freiheit, erschafft Schiller ein Gesamtwerk, das dem Leser durch seinen Realismus viel näher gehen muß, als der Kitsch manch anderer Schriftsteller.
Und damit beweist Schiller auch, daß er recht hat, wenn er in der Huldigung der Künste schreibt:
„Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben.“