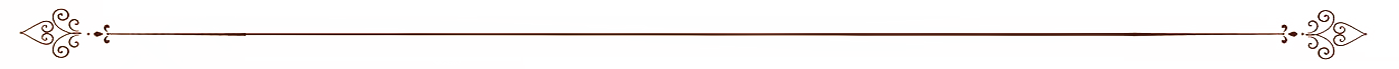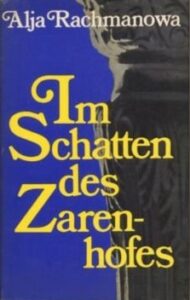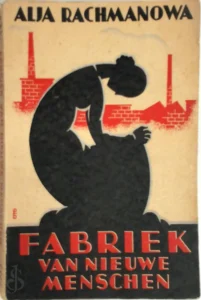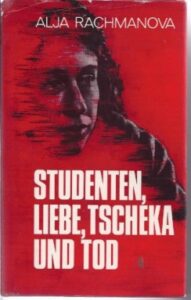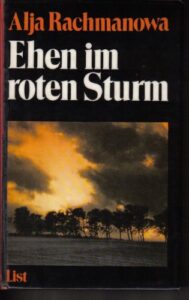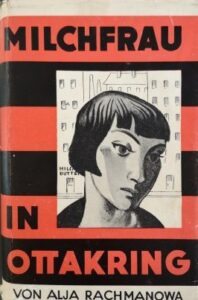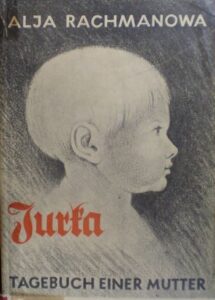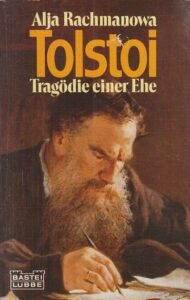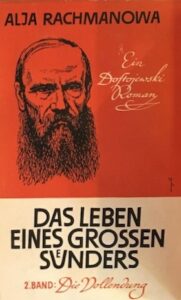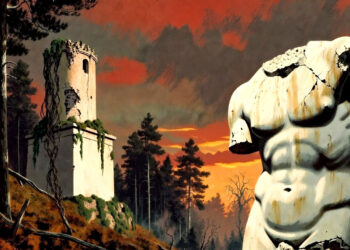Frühjahr 1945: Die Rote Armee ist dabei, das zum „Großdeutschen Reich“ gehörende ehemalige Österreich zu erobern. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie das ganze Land einnimmt. An der wehrlosen Zivilbevölkerung verübt sie zahllose Verbrechen. Man hat es vor allem auch auf ehemalige Sowjetbürger abgesehen, besonders, wenn sie sich antibolschewistisch betätigt haben. Sie werden in die Sowjetunion „repatriiert“, um dort abgeurteilt zu werden.
Es gab daher eine ganze Reihe von Exil-Russen im Deutschen Reich, die sich nun ernsthafte und berechtigte Sorgen über ihr zukünftiges Schicksal machten. Eine von ihnen war die im Zwangsexil in Salzburg lebende russische Schriftstellerin Alja Rachmanowa (geborene Galina Djuragina).
Letzte mahnende Worte des Sohnes
Die Lage wird aussichtslos: Die Rote Armee beginnt am 16. März 1945 mit einer Überlegenheit von 10:1 ihre Offensive zur Einnahme von Wien. Bis zum 15. April dauern die Kämpfe der „Operation Wien“ an. Zu den Verteidigern von Wien zählt der junge Alexander („Jurka“), einziges Kind von Alja Rachmanowa und ihrem österreichischen Ehemann Arnulf von Hoyer. Mit seinen 24 Jahren fällt Sohn „Jurka“ am 1. April 1945 bei den Kämpfen um die Wiener Neustadt. Seine letzten Worte mahnten seine Eltern zur unverzüglichen Flucht. Es war die größte Katastrophe, die über die Familie je hereingebrochen war.
Rettung in letzter Minute
Seinen zutiefst verunsicherten Eltern gelang es schließlich, sich in den letzten Kriegstagen gerade noch rechtzeitig aus Salzburg an den Bodensee abzusetzen, um in die sichere Schweiz zu entkommen. Mit Beharrlichkeit und Glück gelang die Flucht. An der grünen Grenze wurden sie mehrfach zurückgewiesen. Es war purer Zufall, daß ein ihr wohlgesonnener Grenzbeamter die Dichterin Alja Rachmanowa erkannte und an vorgesetzter Stelle die Genehmigung zum Grenzübertritt einholte. Das Paar war gerettet.
Eine wechselvolle Vorgeschichte
Nicht nur die bevorstehenden Kriegshandlungen und die erwartbaren Exzesse durch die Rote Armee zwangen zur Flucht. Als ehemalige sowjetische Staatsbürgerin drohte Alja Rachmanowa eine Auslieferung an die Sowjetunion. Sie war für die Sowjetunion eine erklärte Staatsfeindin. 1925 ohne offiziellen Grund zwangsausgebürgert, galt sie später als eine der weltweit bekanntesten antibolschewistischen Schriftstellerinnen im Exil. In mehreren Büchern, besonders in „Studenten, Liebe, Tscheka und Tod“, „Ehen im roten Sturm“ und „Die Fabrik des neuen Menschen“, beschrieb sie das unerträgliche Leben unter dem Bolschewismus.
Als Zeitzeugin hatte sie eine hohe Glaubwürdigkeit. 1935 wurde ihr Roman „Die Fabrik des neuen Menschen“ in Frankreich mit dem 1. Preis für einen antibolschewistischen Roman durch die „Académie d’Education et d’Etudes Sociales“ ausgezeichnet. Die Nationalsozialisten versuchten, ihre antibolschewistischen Bücher für propagandistische Zwecke auszunutzen, stießen dabei aber an von ihnen selbst gezogene Grenzen.
Ein Leben voller politischer Turbulenzen
Alja Rachmanowa durchlebte auf Grund ihrer politischen Einstellung sowohl in der Sowjetunion, als auch im NS-Deutschland schwierige Zeiten. Ihre Liebe zur russischen Heimat und ein tiefer christlicher Glaube waren die Lebensgrundlagen, die ihr Kraft verliehen. Die Bolschewisten lehnte sie aus grundsätzlichen weltanschaulichen Gründen sowie aus eigenem Erleben ab. Es ging ihr nie um die Restauration des Zarismus oder die Verklärung von Mißständen im alten Rußland.
Das Rußland ihrer Vorstellungen war ein christliches Land, in dem seine Bürger frei leben und sich entwickeln konnten. Konsequent versuchte sie, sich Vereinnahmungsversuchen zu entziehen, eine aktive politische Betätigung lehnte sie strikt ab. Sowohl in der Sowjetunion, als auch im NS-Deutschland war sie allerdings gezwungen, den Herrschenden Zugeständnisse zu machen, um Repressionen gegen sich zu verhindern, aber auch, um ihr Auskommen als Schriftstellerin zu sichern.
Zarenreich, Sowjetunion und Ausweisung
1898 in Kali, in der Nähe von Jekaterinburg geboren, erlebte Alja Rachmanowa eine unbeschwerte Kindheit und frühe Jugend im zaristischen Rußland. Ihre Familie hatte einen bescheidenen Wohlstand, weshalb sie später von den Bolschewisten als „bourgeois“ gebrandmarkt wurde. Als die Februar-Revolution 1917 ausbrach, waren die Erwachsenen in der Familie entsetzt, während die noch junge Alja ihr zunächst neugierig und offen begegnete. Es gab eine, besonders auch in der privilegierten Jugend verbreitete Ansicht, daß der Krieg beendet und die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend verändert werden müßten.
Das böse Erwachen unter der bolschewistischen Herrschaft zerstörte schnell alle Illusionen. Rachmanowa schrieb in ihr Tagebuch: „Der Tag, an dem die Bolschewiken die Macht in die Hand genommen haben, ist der Todestag der russischen Intelligenz. Wir müßten eigentlich unsere sieben Sachen zusammenpacken und ins Ausland emigrieren. Hier in Rußland haben wir nichts mehr zu suchen“.
Die folgende Zeit hat Alja Rachmanowa später in ihren Büchern beschrieben, die auf heimlich verfaßten Manuskripten in russischer Sprache beruhten. Die Familie erlebte Enteignung, permanente Überwachung, Hausdurchsuchungen, Hunger, Krankheiten, Flucht, Verhaftung, Deportation und Ermordung von Familienangehörigen. 1925 erfolgte die Ausweisung von Alja und des Jahre zuvor in der UdSSR geheirateten ehemaligen österreichischen Kriegsfangenen Arnulf von Hoyer mit ihrem gemeinsamen Kind Alexander. Noch lange Zeit später, im Exil, plagte sie Albträume: „Ich bin ja in Österreich, ich bin frei. Niemand kommt zu mir, um mich zu verhaften, niemand droht mir, mich ohne Grund zu erschießen.“ Es sollten nicht die letzten Albträume sein.
Mühsamer Aufstieg in Österreich
Das Leben im österreichischen Exil in Wien war hart. Tag für Tag mußte die Familie ums Überleben kämpfen. In dieser Zeit entstand unter Mühen das bekannteste und sehr erfolgreiche Buch „Die Milchfrau in Ottakring“ (1933 veröffentlicht). Es war Rachmanowas Beharrlichkeit und ihrem unermüdlichen Fleiß zu verdanken, daß 1931 der Durchbruch als Schriftstellerin mit dem ersten Buch ihrer „Tagebuchtrilogie“ begann.
Die Anschaulichkeit, mit der sie die Auswirkung der bolschewistischen Revolution auf das Leben der einfachen Russen und deren Leid schilderte, bewegte gerade deutsche Leserinnen und sicherte ihr eine wachsende Fan-Gemeinde.
Ihr Mann Arnulf von Hoyer konnte 1927 sein Studium abschließen und als Lehrer arbeiten. Er übersetzte nebenbei sämtliche Bücher seiner Frau, die ihre Texte im Manuskript ausschließlich auf Russisch schrieb. Die Familie zog zum Arbeitsplatz von Hoyers nach Salzburg um und blieb dort bis zum Herannahen der Roten Armee 1945. Von Hoyers Einkommen, vor allem aber der schriftstellerische Erfolg, der sich in hohen Auflagen zeigte, ermöglichte dann für wenige Jahre einen wachsenden Wohlstand mit Villa, Automobil und Reisen. Das kurze Glück hatte jedoch keinen Bestand.
Österreich wird Teil des „Großdeutschen Reiches“
Mit dem Anschluß 1938 erfährt Alja Rachmanowa mit ihrer Familie ein Fiasko. Sie geriet in die große und kleine Politik, die zu einem vorläufigen Ende ihrer schriftstellerischen Karriere führte. Arbeits- und Auftrittsmöglichkeiten schwanden und die Zukunft sah eher düster aus. Das aus dem Leben unter dem Bolschewismus bekannte Gefühl persönlicher Bedrohung kam wieder hoch. Offensichtlich war sie erneut in einem totalitären System dessen Willkür ausgesetzt.
Auch in der NS-Zeit zensiert
Nachdem ihre Romane wegen ihrer antibolschewistischen Tendenzen zunächst große Aufmerksamkeit und höchstes Lob im Nationalsozialismus fanden, gab es von Anfang an auch puristische NS-Kritiker, die sich am Weltbild Rachmanowas störten. Ihnen fehlte der Bezug zu Kerninhalten der sich entwickelnden nationalsozialistischen Ideologie.
Während der Phase des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes von 1939 wurden Rachmanowas Bücher aus dem Verkehr gezogen. Öffentliche Auftritte waren nicht mehr möglich. Man wollte die Beziehungen zum Zweckverbündeten im Osten nicht strapazieren.
Neuer Bedarf an antibolschewistischer Literatur
Der NS-Kulturbetrieb ignorierte Alja Rachmanowa. Erst 1941, mit dem Unternehmen „Barbarossa“, war man ihren Werken gegenüber wieder etwas offener. Es erschienen modifizierte Raubdrucke für die Propaganda in besetzten Gebieten im Osten, deren Machart die Rachmanowa ablehnte. Man hatte allerdings im Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg gegen den Bolschewismus wenig Verwendung für sie persönlich, zumal sie kein Buch schreiben wollte, das die NS-Ideologie zur Grundlage hatte. Die ihr zugetragenen Gräuel der NS-Politik mit den düsteren Aussichten für ein erobertes Rußland stießen sie ab. Es blieb bei zwei Broschüren, die sie als gut bezahlte Auftragsarbeit für das Auswärtige Amt anfertigte.
Man konnte sie zudem nicht in eine Reihe mit antibolschewistischen Autoren wie Natascha Gorjanowa („Russische Passion“), P. N. Krasnow (u.a. „Vom Zarenadler zur Roten Fahne“), Karl Albrecht („Der verratene Sozialismus“) oder gar einen Karl Miedbrodt („Die Narren des Kaganowitsch“) stellen, die den Vorstellungen des NS eher entsprachen.
Man erkannte, daß Alja Rachmanowa für den NS keinen besonderen Wert hatte. Sie war zu sehr Russin mit „tatarischem“ Aussehen, zu „judenfreundlich“, inhaltlich zu weit vom NS entfernt, zudem eine bekennende, tiefgläubige Christin. Sie galt als eine willensstarke, erfolgreiche Frau, die sich auch noch für „verdächtige“ Themen wie „Sexualaufklärung“ oder „Psychotherapie“ interessiert hatte. Ihr Bekanntenkreis war dementsprechend überwiegend NS-fern. Nach einer Vorladung zur Gestapo mit einem für sie negativ verlaufenden Gespräch, bildete ein Publikationsverbot den Schlußpunkt im NS-Deutschland.
Verbote und Entpolitisierung im Nachkriegsdeutschland
In der Nachkriegszeit kann man Rachmanowas fortgesetzte schriftstellerische Tätigkeit als überwiegend unpolitisch bezeichnen. Ihre Bücher waren in Deutschland bis 1948 und in Österreich bis 1950 verboten. In der SBZ wurde ihr Gesamtwerk 1946 auf die „Liste der auszusondernden Literatur“ gesetzt. Nachdem jedoch antibolschewistische Romane in der Zeit um den „Kalten Krieg“ im Westen – von Edwin Erich Dwinger bis zu P.N. Krasnow – wieder nachgefragt wurden, erschienen auch solcherart Bücher von ihr im deutschsprachigen Raum in Neuauflage.
Das neue linksliberale Kulturestablishment stellt sie unter Verdacht
Bis in die heutige Zeit wird versucht, Alja Rachmanowa u.a. anhand weniger Zitate aus ihren Tagebüchern, inhaltlich in die Nähe des NS zu rücken. Sie widersprach stets und es dürfte in der Tat schwierig sein, hierfür stichhaltige Beweise zu erbringen. Ihre antibolschewistischen Romane reichen auch heute aus, um sie seitens des linksliberalen Literaturkartells zu ignorieren und schließlich dem Vergessen anheimfallen zu lassen.
Selbst die NZZ legte nach
Nach ihrem Tod 1991 gingen die Versuche einer „Entlarvung“ verstärkt weiter. Erkennbar wird dabei, dass es nicht nur um die Jagd auf eine vermeintliche NS-Mitläuferin ging, sondern dies vor allem mit der Absicht geschah, um hinter ihrer angeblichen NS-Mittäterschaft, die Schilderungen über bolschewistische Verbrechen verschwinden zu lassen oder zu relativieren.
Im Jahr 2015 legte der Deutschlandfunk hier nach und warf mit Bezug auf den Slavisten Heinrich Riggenbach Rachmanowa auch noch vor, dass ihre echten Tagebücher, auf denen ihre berühmten Tagebuchromane basieren, extrem prosaisch und alltäglich seien und sich die Autorin also gewisse literarische Freiheiten genommen haben müsse bei der Umsetzung. Na sowas aber auch! Private Tagebücher werden nicht in Romanform abgefasst?! Eine Literatin macht aus ihren Tagebüchern Literatur statt einer bloßen Transkription?!
Man mag den Kopf schütteln bei solch lächerlichen Anwürfen, aber es geht um eine ernste Sache. Auch wenn das so nicht gesagt wird, ist die Implikation deutlich: Alja Rachmanowa habe sich den Alltagsterror unter der bolschewistischen Herrschaft nur ausgedacht oder zumindest literarisch übertrieben. Das Fehlen einiger der originalen Tagebücher wird dann verschwörungstheoretisch zum Verschwindenlassen von Beweisen umgedeutet.
Würde man vergleichbares über das Tagebuch der Anne Frank äußern, die Kreuzigung wegen Holocaust-Leugnung und Antisemitismus würde direkt auf dem Fuße folgen!
Doch selbst die vermeintlich konservative NZZ hatte am 14.1.2016 einen Schmähartikel gegen sie persönlich und ihre schriftstellerischen Qualitäten veröffentlicht, in dem man aus sicherer heutiger Sicht, die damalige tödliche Bedrohung der Welt durch den Bolschewismus unterschlägt und das zunehmende Überlebensrisiko Alja Rachmanowas im ungünstig verlaufenden Krieg ignoriert. Hatte sie nicht – bei aller Skepsis – das Recht auf ein wenig Hoffnung, daß nach einem Sieg Deutschlands gegen die verhaßte Sowjetunion ein Neubeginn in Rußland erfolgen könnte? Wie sollte sich eine antibolschewistische Exilrussin beim Heranrücken der Roten Armee in einem Kampf auf Leben und Tod 1944/45 positionieren, deren Sohn zwangsläufig gegen ihre eigenen Landsleute kämpfte, um den Bolschewismus aufzuhalten?
Das literarische Werk
Neben ihrer berühmten, in Romanform erschienenen Tagebuch-Trilogie „Studenten, Liebe, Tscheka und Tod“, „Ehen im roten Sturm“ und „Milchfrau in Ottakring“ sowie dem thematisch damit verbundenen „Die Fabrik des neuen Menschen“, wurden von ihr zumeist Romanbiographien russischer Kulturschaffender von Tolstoj bis Dostojewskij veröffentlicht, darunter „Tragödie einer Liebe“, „Wera Fedorowna“ oder „Im Schatten des Zarenhofs“. Ein großer Teil ihrer Bücher hat einen autobiographischen Inhalt, drei davon handeln von ihrem gefallenen Sohn „Jurka“ (Alexander). Bis 1972 konnte sie neue Bücher vorlegen, wovon in der Nachkriegszeit die Mehrzahl ihres insgesamt 20 Bücher umfassenden schriftstellerischen Werkes entstand.
Fazit
Alja Rachmanowa war eine russische Schriftstellerin, die aufgrund der Zeitumstände und ihrer darüber verfaßten Bücher in der Sowjetunion und im „Großdeutschen Reich“ persönlich schwierige Zeiten erlebte. Der linksliberale Kulturbetrieb der Nachkriegszeit ignorierte sie zunehmend. Bis heute wird versucht, sie in NS-Nähe zu rücken und zu ächten. Schon lange gibt es im deutschsprachigen Raum keine Neuauflagen ihrer Bücher mehr. Dennoch bleibt ein unsterbliches, ansehnliches Werk, das in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Alja Rachmanowa wird dennoch unvergessen bleiben. Sie hat als Zeitzeugin und als Literatin auch der Nachwelt einiges zu bieten.