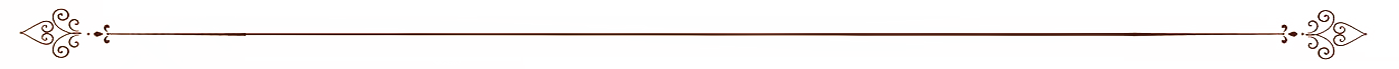Bei meinem Streifzug durch die deutsche Literatur stieß ich auf einen Autor, der genau meinen Nerv traf: Willy Seidel. Denn ohne es zu wissen, war ich auf der Suche gewesen nach exotischen Geschichten aus fernen Ländern und einer wortgewandten Auseinandersetzung mit dem Mythos, welche die Reichhaltigkeit unserer Sprache ausschöpft.
„Da ihn der Aufschlag junger Augen rief,
fiel hell in ihren Grund der Morgenstern.
Kein Berg war uns zu steil; kein Strom zu tief;
Und keine hohe Wolke war zu fern.
Das blieb uns; und wir haben neue Fracht
Hinzugesammelt. Diese Welt ist weit.
Doch mündet alles, was wir je bedacht,
ins Morgendunkel; in die frühste Zeit.“
– Willy Seidel
Ein geborener Literat
Geboren 1887 in Braunschweig, zog seine Familie nach dem Tod seines Vaters nach München. Dort besuchte er das Gymnasium, wo sich erstmals seine Sprachbegabung zeigen sollte. Denn sehr zum Verdruss seiner Lehrer liebte er es, sich fiktive Geschichten auszudenken.
Die literarische Begabung lag offensichtlich in der Familie, denn auch seine ältere Schwester wurde später eine bekannte Dichterin und verfasste sogar eine Kurzbiografie über ihren Bruder! Ein Studium der Biologie und Zoologie brach er ab, um schließlich zu seiner großen Leidenschaft, der Germanistik, zu finden. 1911 promovierte er mit einer Arbeit über Die Natur als Darstellungsmittel in den Erzählungen Theodor Storms.
Der Weltenbummler strandet in New York
Es war eine Ägyptenreise im Jahre 1913 und der auf dieser Reise angefangener Roman (Der Sang der Sakîje), die ihm buchstäblich das Tor zur Welt öffnen sollten: Das Auswärtige Amt des Deutschen Reichs wurde auf ihn aufmerksam, da er mit seinen Texten ein Gespür für fremde Kulturen bewiesen hatte. Er bekam den Auftrag, auf Pazifikinseln Berichte für die reichsdeutsche Kolonialpropaganda zu verfassen, was zu abenteuerlichen Ereignissen führen sollte: Als er 1914 einige Wochen auf Samoa verbrachte, brach der Erste Weltkrieg aus und die britischen Streitkräfte besetzen die deutsche Kolonie Samoa. Knapp entkam Seidel den Briten, indem er gerade rechtzeitig ein Dampfschiff Richtung USA nahm, die zu diesem Zeitpunkt noch neutral waren.
Dort dachte er nicht daran, sich dem amerikanischen Lebensstil anzupassen, sondern widmete sich dem auf Reisen gesammelten Material. Die Bräuche und Legenden der Samoaner waren schließlich wesentlich spannender als das materialistische Treiben in amerikanischen Metropolen! Wie viele Zeitgenossen ging er davon aus, dass der Krieg nicht so lange dauern würde. Daher siedelte er nach New York über in der Erwartung, von dort aus schnell das Schiff in die Heimat zu nehmen. Doch ein Deutscher wie er durfte das Land nicht wieder verlassen.
So konnte er weder militärisch noch am Schreibtisch seinem Vaterland dienen und musste zu seinem Leidwesen bis 1919 in den USA ausharren, was sich auch in seinem amerikakritischen Roman Der neue Daniel widerspiegelt. In New York litt er stark an der Unruhe der Stadt; Krankheiten und Gefühle wie Heimweh kamen noch hinzu. Seine erste Ehe, die er mit einer Engländerin schloss, die er noch in München kennengelernt und der er per Brief das Leben in New York schmackhaft gemacht hatte, scheiterte.
Wieder in der Heimat, wieder auf Reise – und am Schreibtisch
In der Weimarer Republik sah er sich seiner Aufgabe beraubt, denn es gab es nun keine deutschen Kolonien mehr. Umso stärker versuchte er sich als Literat zu behaupten, der seine Reiseerfahrungen in unterhaltende Geschichten verwandelt. Er konnte 1925 den Ullstein Verlag dazu überreden, ihm eine Reise zur Insel Java zu finanzieren: Die 1927 erschienene Geschichte Schattenpuppen ist eine Frucht jener Reise gewesen.
Interessierten sei als Einstieg in Seidels Werk die Geschichte Das älteste Ding der Welt ans Herz gelegt: Wer eine Erzählung sucht, in der groteske Situationsbeschreibungen mit kosmischem Grauen verschmelzen und in der die Essenzen von Seidels Fähigkeiten zusammenkommen, ist hier richtig. Es gibt sogar eine Hörspiel-Interpretation (aus der Reihe Gruselkabinett), weswegen es heutzutage sein bekanntester Text ist – nicht zu Unrecht, wie ich finde. Zu Lebzeiten war die 1930 veröffentlichte und in München angesiedelte Geschichte Jossa und die Junggesellen wohl Seidels meistgelesenes Werk.
Eine Geschichte, die aus der Retrospektive das Adjektiv archäo-futuristisch verdient hat, ist Der Gott im Treibhaus: Ein Mann aus dem futuristisch anmutenden Berlin (es gibt Telefonzellen mit Bildschirmen!) begibt sich auf die Suche nach dem mystischen Naturerleben. Es ist eine geheimnisvolle junge Frau, die ihn in ein Mysterium einweiht. Die Geschichte nimmt ein unerwartetes Ende und schafft es trotz düsterer Ereignisse einen Frohsinn zu vermitteln.
Die ewige Wiederkunft. Ein Buch exotischer Schicksale ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die in verschiedenen außereuropäischen Teilen der Welt spielen und 1925 erstmals erschienen sind. Beeindruckend ist dabei Seidels ethnologisches Hintergrundwissen und die passende Einbettung arabischer Aussprüche (so etwa in Der Garten des Schuchân; diese Geschichte wird mit dem berühmten Nietzsche-Zitat eröffnet: „Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt!“) – wer, anders als der Autor dieser Zeilen, allerdings nie in Ägypten oder Nordafrika war und nicht mit einem entsprechenden ethnographischen Vokabular vertraut ist, könnte mit dem Text fremdeln.
Der Dichter am Ende seines Lebens
Der Frage nach den Ereignissen nach dem Tod nähert Seidel sich in seinen Texten zunächst mit Grotesken. Alarm im Jenseits und Der Weg zum Chef: Apotheose eines Literaten sind humoristische Geschichten, die heute nur den Nerv weniger Zeitgenossen treffen dürften.
Wie an dem anfangs zitierten Gedicht deutlich wird: Willy Seidel konnte auch dichten. So verwunderte es nicht, dass er 1929 den Dichterpreis der Stadt München erhielt. Das Preisgeld konnte er gut gebrauchen. Dass er ein Herzleiden entwickelte, schränkte ihn noch mehr ein. Zudem wurde auch seine zweite Ehe aufgelöst.
Stoffe, für die er sich neben der Phantastik- und Reiseliteratur interessierte, waren mittelalterliche und antike Heldensagen. Zumindest konnte ein Teil der geplanten Geschichten noch zum Abschluss gebracht werden, wenn er auch erst 1936 postum publiziert wurde. 1934 starb Willy Seidel an einem Herzanfall infolge eines Unfalls. Seine Schwester beschrieb ihn als einen unpolitischen Menschen. Die Tatsache, dass beide ca. ein Jahr zuvor das Gelöbnis treuester Gefolgschaft unterzeichnet hatten, trug wahrscheinlich zur recht schwachen Rezeption in der deutschen Nachkriegszeit bei. Einige Texte Willy Seidels sind heute online zu finden, andere wiederum nur antiquarisch zu bekommen.
Der Mythos im Fremden und im Eigenen
Was ich mich nach Seidels Geschichten manchmal fragte, war: Wie ist dieser spielerische Umgang mit den Mythen Europas und denen fremder Völker einzuordnen? Seine Schwester schrieb – offenkundig einen Teil der Geistesgeschichte Europas verkennend – über ihren Bruder:
„Willy war in Deutschland einer der frühesten Vertreter der sich damals zum erstenmal offenbarenden europäischen Geistesströmung, die auf Ergründung jener Seelenschichten gerichtet war, denen man zunächst die sogenannten Primitiven zurechnete wie die außereuropäischen Völker überhaupt. […] Das große Interesse, das mein Bruder in seinem letzten Jahrzehnt okkulten Erscheinungen und ihrer wissenschaftlichen Erforschung entgegenbrachte, liegt somit letztlich auf einer Linie mit seinem ursprünglichen Drang, sich in die Offenbarungen des freier spielenden exotischen Seelenlebens zu versenken.“
Die heutige Germanistik ordnet Seidel primär dem wilhelminischen Exotismus zu. Auf der einen Seite war er stolz darauf, dem Deutschen Reich als Kolonialbeamter gedient zu haben, auf der anderen Seite wollte er eines bloß nicht: den in den Kolonien lebenden Völkern die Riten und Mythen verderben, sie modernisieren um jeden Preis!
Die Geschichte Willy Seidels, der wir uns nun widmen wollen, ist aus europäischer Sicht hingegen alles andere als exotisch: Sie knüpft nämlich an einem festen Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses Europas an. Die Themen Sterblichkeit und Heldentum sind zeitlos. Nichts verbindet diese beiden besser als ein passender Mythos, den ich kurz aus neuplatonischer Sicht betrachten und einschätzen will.
Der Tod des Achilleus: ein wiederbelebter Mythos
Willy Seidel, der sich so ausgiebig mit fremden Kulturen befasste, kehrt hier zu den eigenen Wurzeln zurück, das Metaphysische nicht scheuend. Klar, Seidel war kein Mitglied eines (neu-)heidnischen Mysterienkultes, sein Zugang zum Mythos ist nicht ritueller oder initiatorisch-mystischer, sondern literarischer Natur. Er zeigte mit seinem Achill allerdings auch, wie das Mythische auf eine freie Art bewahrt werden kann, ohne in eine verknöcherte, rein auf Gelehrsamkeit zielende Mythologie abzugleiten.
Die Ilias ist für viele der Beginn der europäischen Literatur. Der Tod des Helden Achilleus (eingedeutscht Achill), der in voneinander abweichenden Versionen überliefert ist, hinterließ in Seidels Seele einen bleibenden Eindruck. Als Grundlage wählte er die wohl bekannteste Version, nach der Apollo (unten im Zitat mit dem Beinamen Phoibos genannt) den Pfeil des Paris lenkte, und arbeitete an einem Text in der Form antiker Dialoge, entschied sich aber letztlich für eine Kurzgeschichte namens Der Tod des Achilleus.
Der Anfang beschreibt nichts Profanes: ein Held, der Sohn eines Königs und einer Nymphe, vergeht: mysterium tremendum, ein erschütterndes Ereignis, ausgelöst durch höhere Mächte!
„Über dem Hellespontos spaltete sich eine Wolke. Es blitzte golden. Ein Strahl schoß hervor, tastete über das Blachfeld und erlosch. Achilleus rasselte nieder. Ächzend griff er nach der rechten Ferse und drehte die blutverschleierten Augenbälle wie drohend gen Himmel. Was war dies Rauschen, das ihm das ungeheure Geschrei bald herzutrug, bald in Entfernung schob?“
Den letzten Kampf mit blutender Wunde beschreibt Seidel plastisch wie eine Szene aus dem Film 300:
„Der Pelide zerbrach ihnen mit den Speeren die Schädel, so daß ihre Helme wie blutbespritzte Becherscherben in den Staub rollten.“
Im Stil pendelt Seidel zwischen mystischen Beschreibungen und Abenteuerroman.
Die Reise nach dem Tode
Achills Geist ist hartnäckig und löst sich nur langsam vom Leichnam.
„Es war Mühe, den Schildgriff von der eisernen Umklammerung zu lösen. Noch war der Krampf des »Zu früh!« in die Züge gemeißelt.“
Der Geist kann die Klageworte nicht verstehen, aber er kann sie fühlen. Er wird aufgebahrt. Thetis erscheint mit ihren Nereiden und betrauert den toten Sohn, der daran leidet, dass er als Geist nicht mehr mit ihr interagieren kann. Die alten Opferriten erfüllen ihren Zweck: Achills Geist kann sie riechen, den Duft genießen, sie begleiten ihn auf seinem Weg in die Unterwelt.
Schließlich wird sein Leichnam verbrannt.
„Auf dem Zedernholzturm lag der Leichnam und leuchtete. Der Geist des Achilleus umkreiste ihn mit lautlosen Schwingenschlägen; seine gespreizten Arme, zwischen denen sich ein Etwas blähte wie Stoff eines Gewandes, durchfächelten die Luft.“
Er durchstreift die Unterwelt und nach und nach lösen sich gewohnte Wahrnehmungen auf. Patroklos erklärt ihm beim Anblick des Sisyphos: „Es gibt hier keine Zeit. – Es ist die ewige Gegenwart.“ Wir befinden uns nicht mehr in Gefilden, die mit Worten zu beschreiben sind. Die letzten Sätze der Geschichte lauten wie folgt:
„und er [Patroklos] faßte an seine Stirn und deutete dann, mit rührendem Lächeln, an die des Freundes; denn da drinnen lohte es ja noch, das goldne Funkeln, die brennende Sehnsucht nach Phoibos; der ungeheure Groll, von ihm verworfen zu sein – dann beugten sie sich, ohne einander weiteres zu sagen, gemeinsam nieder zum Wasser des Vergessens.“
Das ist ein ungewöhnliches Ende: In vielen historischen Quellen ist Achill die Erinnerung an die großen Taten wichtiger, auch wenn dies Bindung an die Unterwelt bedeutete.
Die Wahrheit des philomythos
Nach platonischer Lehre ist es eine Aufgabe des Menschen, sich zu erinnern, an den menschlichen Platz im Kosmos, auch an frühere Leben, an die Unterwelt und an die Götter, um so auf dem Weg vieler Reinkarnationen zum Göttlich-Jenseitigen letzten Endes den Fluch zu brechen. Achill wird als jemand präsentiert, der – wie gewöhnliche Menschen – das Lethe-Wasser trinkt, vergisst und sich im nächsten Leben durch Erinnerung zu veredeln hat. Er ist noch vom höchsten Göttlichen getrennt, wenn er zugleich die Macht der Götter ganz nahe bei sich fühlt.
Der Mythos drückt die Wahrheit in kompakter und verbergender Gestalt aus: Er zieht den Kosmos, die Sterblichkeit, die Ewigkeit, die Gemeinschaft und das Individuum zusammen. Die Philosophie hingegen differenziert und stellt eine andere Form der Wahrheitssuche dar. In Seidels Brust schien eher das Herz eines philomythos zu schlagen als das eines philosophos, um eine aristotelische Unterscheidung aufzugreifen. Zur Wahrheit führen beide Pfade. Eine einfache Wahrheit lautet: wir alle begegnen dem Tod, auch Helden wie Achill. Mythen sind mit dem Ewigen verbunden; sie können ihre Aktualität gar nicht verlieren. Wir sind diejenigen, die Gefahr laufen, den vitalen Bezug zu ihnen und damit einen bestimmten Wahrheitssinn einzubüßen.