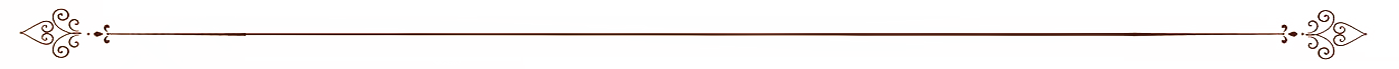In der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre war das Bild, das man sich in der Science-Fiction im Allgemeinen von der Zukunft machte, ein überwiegend optimistisches. Man denke an Star Trek oder Perry Rhodan.
Das nahm mit Blade Runner ein abruptes Ende. Blade Runner etablierte das Cyberpunk-Genre im Kino; Cyberpunk bedeutet eine hochtechnisierte, aber moralisch bankrotte Welt, „High-Tech, Low-Life“. Eine Welt, in der sich die alten Zukunftshoffnungen auf Aufklärung, Freiheit, Entwicklung, Wohlstand und Schönheit nicht erfüllt haben, sondern im Gegenteil: die moderne Technik den Menschen korrumpiert hat, anstatt ihn emporzuheben.
Dass sich diese Trendwende von optimistischer zu pessimistischer Science Fiction vollzog, ist verständlich. Science Fiction ist immer eine Extrapolation der Gegenwart – und eine Zukunft im Sinne von „Wirtschaftswunderjahre im Weltraum“, wie in den 60ern erträumt, wurde einfach immer unrealistischer und passte schlicht und ergreifend nicht mehr zu den aktuellen Trends des Westens. Eines Westens, aus dessen Zukunft sein Erschaffer – der weiße Mann – mittels Masseneinwanderung in fast all seine Länder weitestgehend ausradiert wurde.

Für Blade Runner sah man sich die schon damals verelendenden Großstädte wie Chicago, Detroit und Baltimore an und extrapolierte deren Verhältnisse in die Zukunft: Blade Runner spielt in einem verkommenen zukünftigen Los Angeles von 106 Millionen Einwohnern. Dort gibt es keine Bürger mehr, nur noch Bewohner. Kein Volk, nur noch ein Völkergemisch. Keine Pflanzen und Tiere, nur noch Hochhäuser, Beton und Anonymität. Die Umwelt scheint zerstört zu sein, permanent regnet es. Gezeigt wird uns dieser Moloch anhand des Fahnders Rick Deckard (Harrison Ford), eines identitätslosen Rädchens im großen Getriebe.
In diese Welt bricht nun der Replikant Roy Batty alias Rutger Hauer ein. Replikanten sind künstliche, für Arbeitseinsätze im Weltraum gezüchtete Menschen, die eine Lebensspanne von nur vier Jahren haben. Ihnen ist das Betreten des Planeten Erde untersagt. Roy Batty wurde als Soldat entworfen und verfügt über überlegene Intelligenz und Körperkraft. Aber etwas läuft nicht wie geplant: Roy entwickelt einen Überlebenswillen und sucht auf eigene Faust seinen Schöpfer (einen Biotechnologie-Unternehmer) auf der Erde auf, um ihn dazu zu zwingen, sein Leben zu verlängern. Dies scheitert, Roy nimmt blutige Rache und muss nach allerlei Action-Szenen und nachdem er seinem Gegenspieler Deckard in einer überraschenden Geste der Milde das Leben rettet, sterben – weil seine vierjährige Lebensuhr gerade in diesem Moment abläuft. In seiner letzten Minute spricht er den Monolog, der in die Filmgeschichte einging:
„Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser-Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.“
Worte von erhabener Schönheit, gesprochen in einer Welt des Abfalls. Viel schon wurde in den Charakter Roy Batty und seine „Tears in the Rain“-Szene hineininterpretiert. Für mich allerdings ist er vor allem eines: ein Symbol für den weißen Mann. Roy ist eine Reminiszenz an die alte, optimistische Zukunft, die uns früher einmal verheißen wurde. Ein Übermensch, der von den Sternen herabgestiegen ist, um Rache zu nehmen dafür, dass ihm und seinesgleichen die Zukunft verwehrt wurde. Und klingen seine Worte nicht stark nach unseren alten, westlichen Zukunftsträumen? C-Strahlen, die glitzernd die Nacht über dem Tannhäuser-Tor erhellen … brennende Kampfschiffe weit draußen vor der Schulter des Orion … ? Das klingt nicht nach der dystopischen, überbevölkerten Blade-Runner-Zukunft, sondern nach der Zukunft, wie sie hätte sein sollen. Nach Aufbruch in den Weltraum. Nach Abenteuern. Nach Großem.
Und warum spricht Roy eigentlich ausgerechnet vom Tannhäuser-Tor? Tannhäuser, jene Wagner-Oper, die so eindringlich den Konflikt zwischen dem Streben nach Höherem (apollinisches Prinzip) und dem Lustprinzip (dionysisches Prinzip) beschreibt. Es ist das apollinische Prinzip, für das Roy Batty steht und welches alle optimistischen Zukunftsvisionen konstituiert. Das dionysische Prinzip (primitivste Lustbefriedigung, Dekadenz, Laissez-faire) hingegen ist es, welches die Welt von Blade Runner beherrscht … und ruiniert. Parallel dazu ist es in der Wagner-Oper das Anheimfallen an das dionysische Prinzip, welches das Leben des Minnesängers Tannhäuser zugrunde richtet. Auch ähneln sich die Todesszenen von Roy Batty und Tannhäuser stark. Beide sterben einsam, in Anwesenheit von nur einer Person. Beide brechen langsam in sich zusammen, ohne Krankheit, ohne äußere Verletzung, sondern weil ihre „Zeit zu sterben“ gekommen ist. Und beide monologisieren in ihrer letzten Minute, rufen ein letztes Mal das Erhabene und Schöne an.
Rutger Hauer war mit seinem Charakter Roy Batty auf eine Weise verbunden, die ungewöhnlich ist – sie teilen sich sogar das gleiche Todesjahr (Blade Runner spielt im Jahre 2019). „Half of my soul became Roy Batty“, wie er kurz vor seinem Tod in einem Interview sagte. Und er sagte: „Das Verrückteste ist, dass, als ich den Film machte, ich tatsächlich die Zukunft sah. Ich wusste damals nicht, was ich dort sah, aber heute weiß ich, es war die Zukunft.“ Keine unbedeutende Aussage, wenn man bedenkt, wie finster die Welt von Blade Runner ist.
Ich finde, wir sollten neue Science-Fiction-Visionen erschaffen. Keine Dystopien. Sondern etwas, das uns ein Leitstern ist. Ein Ideal, auf das wir uns zubewegen können. Eine Renaissance Europas im Weltall, in welchem wir endlich den Schatten abstreifen können, der über uns ethnischen Europäern liegt. Eine Welt, in der wir diejenigen sind, die in gigantischen Schiffen auf glitzernden C-Beams durch das Tannhäuser-Tor reiten.