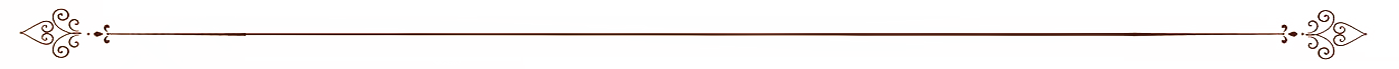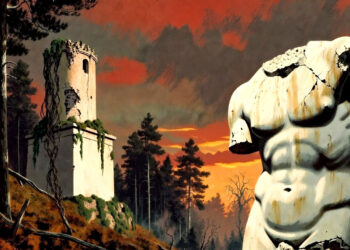„Mit Tosko Lantuschoks Gabeln sammelt der Hunger die toten Körper von Mytro Kin und seiner Pascha vom Hof, und da ist er schon bei Oksana, ihrer Tochter. Sie liegt dicht am Flechtzaun, die wassergefüllte Hand darunter durchgestreckt, hatte dort wohl junges Gras entdeckt… Mit Schwung pflanzt er ihr Toskos Gabel in die Brust, da zuckt sie auf einmal und fängt an zu schreien: „Ich lebe! Ich lebe!“, kreischt sie, dass gleich der Himmel aufreißt. Und er darauf zustimmend, aber nüchtern: „Macht nichts, bis morgen bist du eh tot, so muss ich nicht noch mal herkutschen für dich…“ Und sticht wieder mit der Gabel zu. Oksana ist noch warm. Sie hätte zumindest noch ein paar Stunden auf der Welt gehabt“. („Das Zeitalter der roten Ameisen“, S. 337 f.)
Sie saßen oder lagen apathisch herum, kaum einer Bewegung mehr fähig. Zwischen ihnen immer mehr Sterbende. Leichen im Haus und auf der Straße: Der Hungertod war allgegenwärtig. Man kam mit dem Einsammeln der Leichen kaum hinterher. Es gab keinerlei Hoffnung mehr, dafür Wut und dumpfe Verzweiflung. Wird es jemals aufhören, kann man irgendwie überleben? So stand es im Jahr 1932 um die Ukraine. Tanya Pyankova hat in ihrem Roman „Das Zeitalter der roten Ameisen“ dem leidenden ukrainischen Volk dieser düsteren Zeit ein Denkmal gesetzt.
Antirussische Propaganda?
Pyankovas teils drastische Schilderungen muten wie kranke Phantasien, ja wie antirussische oder antibolschewistische Propaganda an. Da stellt sich die Frage nach dem realen historischen Hintergrund. Wie authentisch sind ihre Schilderungen, die bis zum Kannibalismus reichen?
„Der Ilko ist lang aufgegessen. Na und? Andere machen dasselbe! Er ist hingefallen, vor dem Haus draußen, hingefallen und dann steifgefroren! Hat sich im Frost lange gehalten. Und die Kinder hatten doch Hunger? Ich habe ihnen jeden Tag ein Stück gegeben… Dem Ilko ist es doch einerlei, ob auf der Erde oder unter der Erde. Sein Geist ist zu Gott geflogen. Ich musste die Kinder doch mit irgendwas füttern. Ich gehe frühmorgens alleine vors Haus, säble ein bisschen ab von ihm, und wir haben genug für den ganzen Tag. Viel geht nicht, sonst reißen die Därme…“. („Die roten Ameisen“, S.269)
Angesichts solcher Szenen packt den Leser das Grauen. Wie konnte es so weit kommen? Verhungern in der „Kornkammer des Russischen Reiches“? Die Antwort ist einfach: Nach dem bolschewistischen Umsturz vom Oktober (November) 1917 sollte wenige Jahre später mit aller erforderlichen Gewalt ein neues kommunistisches Wirtschaftssystem auf Kosten der Bauern eingeführt werden.
Kernproblem Zwangskollektivierung
Es begann schon unter Lenin:
„Der Bauer muss ein wenig Hunger leiden, um dadurch die Fabriken und die Städte vor dem Verhungern zu bewahren. Im gesamtstaatlichen Maßstab ist das eine durchaus verständliche Sache; dass sie aber der zersplittert lebende verarmte Landwirt begreift – darauf rechnen wir nicht. Und wir wissen, dass man hier ohne Zwang nicht auskommen wird – ohne Zwang, auf den die verelendete Bauernschaft sehr heftig reagiert.“ (Dietz, Gesammelte Werke 1920/21, S. 172).
Auch für seinen Nachfolger Stalin war die Zwangskollektivierung eine fixe Idee.
Stalin „war zu dem Schluß gekommen, daß die Bauern geopfert werden mußten, um die UdSSR zu industrialisieren“. („Der Rote Hunger“, Anne Applebaum, S. 126)
Stalin war der Hauptschuldige
Der Historiker Robert Conquest benennt den Hauptschuldigen:
„Stalin steht hinter der Tragödie von 1930 bis 1933“. („Ernte des Todes“ S. 13)
Daneben fallen alle anderen Faktoren, wie das Wetter oder regionale Besonderheiten, nicht ins Gewicht. Stalin benannte mit den „Kulaken“ und den „ukrainischen Nationalisten“ gemäß der gut bolschewistischen Tradition Sündenböcke, die seine Politik der Rück- und Fehlschläge rechtfertigen sollten.
Dazu schrieb Anne Applebaum:
„War eine gewaltsam durchgesetzte Kollektivierung wirklich die einzige Lösung? Natürlich nicht… Doch Stalins Verständnis der sowjetischen Landwirtschaft, sein ideologischer Fanatismus und seine eigenen Erfahrungen – vor allem sein Glaube an die Wirksamkeit von Terror – ließen ihm die massenhafte Zwangskollektivierung notwendig und unabdingbar erscheinen.“ („Roter Hunger“ S. 126).
Die Erfindung des „Kulaken“
Durch die Erfindung des „Kulaken“ wurde eine künstliche Spaltung der Bauern in „Kulaken“ (überwiegend besitzende, erfolgreiche Bauern) und die übrigen Bauern (besitzlose, arme, erfolglose Bauern) herbeigeführt. Der dadurch leichter zu führende „Klassenkampf“, zumeist mit Hilfe der „Komitees der Dorfarmut“, mußte erklärtermaßen früher oder später zur Vernichtung des „Kulaken“-Klassenfeindes führen.
In Tanya Pyankovas Buch wird ein Gespräch zwischen zwei Frauen der Roten wiedergegeben, in dem eine von ihnen die Wahrheit kennt, während die andere noch naiv in der Phantasiewelt der roten Propaganda lebt:
„Es gibt keine Kulaken.“
„Wie es gibt keine?“
„Das sind einfach Menschen, Solja… Das sind Menschen, die bis vor Kurzem noch Land besaßen und Vieh, sie bauten Getreide an, hatten Gärten, machten Öl und Honig. Und alles, was sie und ihre Kinder hatten, hatten sie sich aus eigener Kraft und im Schweiße ihres Angesichts erarbeitet“ …
„Der Staat hatte Ausgaben in Millionenhöhe und kranke Ambitionen… Der Staat fürchtet sich vor den Schwielen an ihren Händen, denn wer gestern noch eine Schaufel schwang, der kann morgen auch eine Waffe halten!“ …
“Der Staat hat den einen ihr Hab und Gut geraubt, um es anderen zu geben, und zwar solchen, die es vielleicht gar nicht verdient gehabt hätten, weil sie ihr ganzes Leben auf anderer Leute Kosten gelebt haben“ …
„Es gibt keine Kulaken, das sind Leute, denen man ihr Brot abnimmt und ihren Besitz! Das sind Familien, da haben sie die Männer abgeführt und nach Sibirien verbracht, die Frauen in die Kolchosen getrieben, und die Kinder krepieren, die sterben an Hunger!“
„Niemand bezahlt sie für ihre ehrliche Arbeit. Und der Teller trübe Brühe, den man kaum Suppe nennen kann, der ist nur ein anderer Weg ins Grab.“
(Auszug, S. 356. ff.)
Die Katastrophe folgt
Mit dem Bolschewismus kam der Mangel an Nahrung in ganz Sowjetrussland. Immer mehr Menschen konnten nun persönlich erfahren, was Hunger war, soweit sie ihn in der Folge von Krieg und Bürgerkrieg noch nicht kannten. Doch es gab Unterschiede im Land. Gemäß der Politik der Bolschewisten wurden die Städte mit ihrer rücksichtslos im Aufbau befindlichen Industrie bevorzugt mit Nahrungsmitteln beliefert, wenngleich auch dies nur unzureichend geschah. Man muß nicht besonders erwähnen, daß die Roten natürlich bestrebt waren, für sich selbst ausreichend Nahrungsmittel zu horten. Selbst in der größten Hungersnot wurde zum Zwecke der Finanzierung der Industriepläne weiterhin Getreide exportiert.
Der Nahrungsanbau ging als Folge des Umbaues drastisch zurück und führte zu deutlich geringeren Ernten. Der Nutztierbestand sank ebenfalls. Geschätzte 3,5 bis 4 Millionen Tote kostete dieses Experiment das Ukrainische Volk.
War es gezielt gegen die Ukraine gerichtet?
Der ukrainische Nationalismus wurde von den Bolschewisten als konterrevolutionäre Bestrebung bekämpft. Kurz vor dem Holodomor versuchte man allerdings kurzzeitig ihn für die eigenen Zwecke nutzbar zu machen.
Das Ergebnis enttäuschte Stalin, weil entgegen seiner Hoffnungen selbst die kommunistischen Ukrainer zu weitgehende nationale Tendenzen zeigten, anstatt das übergeordnete Prinzip der „Union der sozialistischen Sowjetrepubliken“ zu stärken. Stalin hatte eine starke Abneigung gegen alles Ukrainische entwickelt. Letztlich wurden Tausende der ukrainischen Genossen wegen ihrer angeblich zu extremen nationalen Bestrebungen erschossen und die Russifizierung wieder in vollem Umfang aufgenommen.
Überleben war für viele unmöglich
Der polnische Konsul in Kiew, Stanislaw Sosnicki übermittelte einen ausführlichen Bericht, in dem er u.a. ausführte:
„Mitte Juni [1933] sahen die Einwohner von Charkow regelmäßig den Anblick von sterbenden Menschen auf den Hauptstraßen der Stadt sowie von phantomartigen Menschen mit verwirrten Augen, die ziellos durch die Stadt zogen.“ (Robert Kuśnierz/Philip Redko: The Impact of the Great Famine on Ukrainian Cities, S. 15ff.)
Drei Zitate aus Applebaums Buch illustrieren die verzweifelte Lage exemplarisch:
„Viele Überlebende erlebten entweder Kannibalismus oder – weit häufiger – Nekrophagie, das Verzehren der Leichen von Hungertoten“. (S. 324).
„Andere kochten Gürtel und Schuhe, um das Leder zu essen“. (S. 334).
„Auch sexuelle Nötigung wurde als Waffe benutzt. Ein Brigadier sagte mehreren Frauen, wenn sie mit ihm Sex hätten, bräuchten sie ihr Getreide nicht abzugeben.“ (S. 302).
Robert Conquest:
„Ein Viertel der Landbevölkerung lag im Sterben. Die übrigen hatte der Hunger teilweise so entkräftet, daß sie nicht einmal ihre Angehörigen oder Nachbarn begraben konnten“. (S. 9).
Widerstand?
Widerstand gab es. Einzeln und in Gruppen kam es zur Gegenwehr gegen die bolschewistischen Besatzer. Er wurde brutal niedergeschlagen. Zu Zigtausenden wurden die Bauern erschossen, Hunderttausende deportiert. 1932, auf dem Höhepunkt des Holodomor (Vernichtung durch Hunger) war der Widerstandswille endgültig gebrochen. Roter Terror in Verbindung mit Hunger hatten sie besiegt.
Applebaum resümiert:
“Ein hungernder Mensch ist einfach zu schwach, um sich zu wehren“. (S. 299).
Von Pasternak bis Kopelew
Es gab indes auch Schriftsteller, die den Holodomor mit eigenen Augen sahen oder sogar als Täter aktiv mitgemacht haben.
Der 1958 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnete Dichter Boris Pasternak schrieb in seinen Memoiren:
„In den frühen 30er Jahren gab es eine Bewegung unter den Schriftstellern, hinauszufahren zu den Kollektivfarmen und Material über das neue Leben auf dem Land zu sammeln, Ich wollte auch dabei sein und unternahm meinerseits eine solche Reise mit dem Ziel, ein Buch zu schreiben. Was ich sah, ließ sich nicht in Worten ausdrücken. Ich lernte ein so unmenschliches, so schreckliches Elend kennen, daß es mir fast abstrakt erschien. Dieser Anblick lag jenseits aller Grenzen des Vorstellungsvermögens. Ich wurde krank. Ein ganzes Jahr konnte ich nichts schreiben.“ (Conquest S. 16 f.)
Der spätere Schriftsteller Lew Kopelew war als Täter aktiv am Holodomor beteiligt und schrieb in seinem Buch „und schuf mir einen Götzen“:
„Ich hörte, wie die Kinder schrien, sich dabei verschluckten, kreischten. Ich sah die Blicke der Männer. Eingeschüchterte, flehende, haßerfüllte, stumpfergebene, verzweifelte oder in halbirrer böser Wut blitzende… Es war quälend und bedrückend, all dies zu sehen und zu hören, und noch bedrückender war es, selbst dabei mitzumachen. Nein, falsch…ich wagte nicht, schwach zu werden und Mitleid zu empfinden. Wir vollbrachten doch eine historische Tat. Wir erfüllten eine revolutionäre Pflicht. Wir versorgten das sozialistische Vaterland mit Brot.“ (Dmytro Zlepko: „Der ukrainische Hunger-Holocaust“, S. 13).
Tanya Pyankova über ihr Buch
„Dass meine Seelenstärke ausreichen würde, um über den Holodomor in unserer alltäglichen, menschlichen Sprache zu sprechen, mit einem Mund, der auch Fleisch kaut, Wein trinkt, küsst, flucht, singt… Einen geschlossenen Text über den Holodomor zu verfassen, von einem künstlerischen ganz zu schweigen, kam mir völlig unrealistisch vor. Es erschien schlicht nicht machbar, diese ungeheure Anzahl menschlicher Tragödien in eine klar umrissene Handlung zu fassen.“ („Die roten Ameisen“, S. 418).
„Dieser Roman handelt vom Unterschied zwischen den Ukrainern und den lügnerischen moskowitischen Horden, deren Methoden ständige Angriffskriege, Propaganda, Manipulation und Geschichtsfälschung sind. Er handelt von der Verantwortung für die Verbrechen der russischen Besatzungsmacht gegen die ukrainische Nation und Menschlichkeit“. (S. 422).
Pyankova hat das historische Geschehen belletristisch so umgesetzt, daß es einerseits lesenswerte Dichtkunst auf ansprechendem Niveau ist, andererseits historisch einer kritischen Überprüfung standhält. Ihr ist es gelungen, ein literarisches Abbild der Geschichte zu schreiben, das allen Anforderungen gerecht wird. Sie hat die literarische Herausforderung bestanden.
Verschiedene Erzählstränge
In verschiedenen Erzählsträngen wird das Schicksal der Menschen in den betroffenen Gebieten geschildert. Sie werden immer wieder abgebrochen und nach einer Weile neu aufgenommen. Das schafft eine zusätzliche Spannung und zeigt die Eskalation in ihren Stufen. Es hilft auch, die Schicksale zu vergleichen. Diese Erzählstränge verbinden sich schließlich auf einer höheren Ebene zu einem Gesamtbild, das vom großen Hunger und der Willkür der Besatzer dominiert wird.
Eine Sicht auf alle Seiten
Um zu einem vollständigen Bild zu gelangen, wird die sich vollziehende Katastrophe aus verschiedenen Sichtweisen geschildert. Da sind die Opfer aller Art, aber auch die brutalen Täter und natürlich jene, die letztlich beides sind. Die Frage, ob es Widerstand gab, wird ebenso beantwortet, wie die Frage der Motivation der Täter. Dabei ist es keine Schwarzweiß-Malerei. Pyankova versteht sich auch auf die Grautöne. Natürlich gab es auch Zweifel auf Seiten der russischen und ukrainischen Täter. Idealismus, Zwang, Unwissen und Verblendung stehen neben Sadismus und purer krimineller Energie. Die Erzählebene ist die der „kleinen Leute“, die am meisten unter den Verhältnissen zu leiden hatten.
Fazit
Der vor dem Hintergrund des „Holodomor“ geschriebene Roman von Tanya Pyankova ist ein großer Wurf. Literarisch ist es gelungen, historisch entspricht es den Fakten. Wer wissen will, warum die Ukraine unabhängig sein will und warum sie einen Kampf auf Leben und Tod gegen Russland kämpft, sollte dieses empfehlenswerte Buch lesen. Es offenbart die Tragik eines Bruderkrieges, dessen Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen. Es ist vor allem eine literarische Anklage, geschrieben von einer ukrainischen Patriotin.