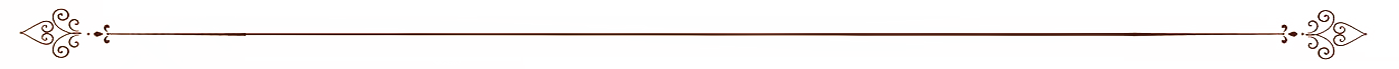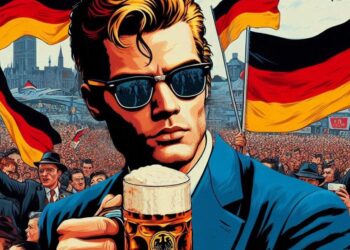Es war ein dunkler Tag in der deutschen Geschichte, der 18. Juni 1849 in Stuttgart. Ludwig Uhland und die ungefähr 100 Abgeordneten des sogenannten „Rumpfparlaments“, dem Überbleibsel des „Paulskirchen-Parlaments“ von 1848, standen wütend vor verschlossener Tür. Die württembergische Regierung hatte zur Verhinderung der anberaumten Sitzung einfach das Tor zum Sitzungssaal dicht gemacht.
Die empörten Abgeordneten zogen spontan in einem Protestmarsch durch die Straßen. Daraufhin ließ Großherzog Leopold den Marsch mit militärischer Gewalt beenden. Die Abgeordneten wurden gewaltsam auseinandergetrieben.
Beendet war damit auch die letzte Hoffnung auf ein freies Deutschland, das aus der Revolution von 1848 hervorgehen sollte. Die „Reaktion“ hatte auf ganzer Linie über das aufmüpfige Volk gesiegt.
Für Ludwig Uhland war es das Ende seiner öffentlichen politischen Betätigung. Er konnte froh sein, nicht weiter verfolgt zu werden. Was ihm blieb, war seine Dichtkunst.
Das Lied vom „guten Kameraden“
Nichts steht heute mehr für Uhland, als dieses Lied. Es ist weltweit beliebt und wurde in viele Sprachen übersetzt:
Ich hatt’ einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt.Eine Kugel kam geflogen,
Gilt’s mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen,
Er liegt mir vor den Füßen,
Als wär’s ein Stück von mir.Will mir die Hand noch reichen,
Derweil ich eben lad.
Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib du im ew’gen Leben
Mein guter Kamerad!
Erbärmlicher Zeitgeist
Natürlich hat man in der heutigen BRD, ähnlich wie einst in der DDR, damit seine Probleme, die den geistigen Zustand unseres neurotisierten Volkes offenbaren: Selbst der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der das Lied zur Totenehrung und bei Kranzniederlegungen nutzt, knickt gegenüber dem Zeitgeist ein:
„Die Melodie ist das Symbol – der Text spielt keine Rolle mehr. Und das ist gut so, hat doch vor allem die dritte Strophe für heutiges Verständnis irritierenden Charakter… Richard von Weizsäcker hat übrigens als Bundespräsident 1993 prüfen lassen, ob „Der gute Kamerad“ noch in die politische Gedenkkultur des wiedervereinigten Deutschlands passt. …“
(Homepage des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: „Das Lied vom guten Kameraden“)
Derartige Anwürfe werden weder dem weltweit praktizierten militärischen Zeremoniell noch dem Geist des Dichters gerecht. Ein wenig erinnert es an den peinlich-lächerlichen Umgang mit dem „Deutschlandlied“, das man auf die 3. Strophe reduzierte und das ebenfalls aus dieser Epoche stammt.
In dunkler Zeit entstanden
Ludwig Uhland schrieb das Lied vom „guten Kameraden“ 1809, in einer dunklen Zeit, in der Napoleon große Teile Europas im Würgegriff hatte. Anlass bot der Tiroler Freiheitskampf, in dem im Auftrag von Napoleon fremdbestimmte Deutsche aus Bayern gegen freiheitsliebende Deutsche aus Tirol standen. Vertont wurde es 1825 durch Friedrich Silcher.
Der DDR-Künstler Ernst Busch verschandelte es für sein „Hans-Beimler-Lied“ in Erinnerung an jenen bolschewistischen Polit-Kommissar des rotspanischen „Thälmann-Bataillons“ im Spanischen Bürgerkrieg. Bekanntermaßen standen auch dort Deutsche gegen Deutsche.
Patriotische Gedichte
Zu Uhlands Werk zählen seine politischen Gedichte. Sie werden in inhaltlich moderater Form dargebracht, ohne die Grenzen des Sagbaren zu überschreiten. Es war die Zeit nach den Befreiungskriegen 1813-15, die dem Deutschen Volk Anlass zu Hoffnungen auf mehr politische Teilhabe gaben.
Am 18. Oktober (1816)
Wenn heut ein Geist herniederstiege,
Zugleich ein Sänger und ein Held,
Ein solcher, der im heil’gen Kriege
Gefallen auf dem Siegesfeld,
Der sänge wohl auf deutscher Erde
Ein scharfes Lied, wie Schwertesstreich,
Nicht so, wie ich es künden werde,
Nein, himmelskräftig, donnergleich:«Man sprach einmal von Festgeläute,
Man sprach von einem Feuermeer,
Doch was das große Fest bedeute,
Weiß es denn jetzt noch irgendwer?
Wohl müssen Geister niedersteigen,
Von heil’gem Eifer aufgeregt,
Und ihre Wundenmale zeigen,
Daß ihr darein die Finger legt.»Ihr Fürsten! seid zuerst befraget:
Vergaßt ihr jenen Tag der Schlacht,
An dem ihr auf den Knien laget
Und huldigtet der höhern Macht?
Wenn eure Schmach die Völker lösten,
Wenn ihre Treue sie erprobt,
So ist’s an euch, nicht zu vertrösten,
Zu l e i s t e n jetzt, was ihr gelobt.Ihr Völker, die ihr v i e l gelitten,
Vergaßt auch ihr den schwülen Tag?
Das Herrlichste, was ihr erstritten,
Wie kommt’s, daß es nicht frommen mag?
Zermalmt habt ihr die fremden Horden,
Doch innen hat sich nichts gehellt,
Und Freie seid ihr nicht geworden,
Wenn ihr das Recht nicht festgestelltIhr Weisen! muß man euch berichten,
Die ihr doch alles wissen wollt,
Wie die Einfältigen und Schlichten
Für klares Recht ihr Blut gezollt?
Meint ihr, daß in den heißen Gluten
Die Zeit, ein Phönix, sich erneut,
Nur um die Eier auszubruten,
Die ihr geschäftig unterstreut?Ihr Fürstenrät‘ und Hofmarschälle
Mit trübem Stern auf kalter Brust,
Die ihr vom Kampf um Leipzigs Wälle
Wohl gar bis heute nichts gewußt,
Vernehmt! an diesem heut’gen Tage
Hielt Gott der Herr ein groß Gericht.
Ihr aber hört nicht, was ich sage,
Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht.Was ich gesollt, hab‘ ich gesungen,
Und wieder schwing‘ ich mich empor;
Was meinem Blick sich aufgedrungen,
Verkünd‘ ich dort dem sel’gen Chor:
Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen,
Untröstlich ist’s noch allerwärts:
Doch sah ich manches Auge flammen,
Und klopfen hört‘ ich manches Herz.
Gegen die Reaktion
Die reaktionären Herrscher aus dem Erbadel wollten nach 1815 vergessen machen, daß das Volk in Deutschland den maßgeblichen Anteil an der Befreiung hatte. Sie wurden immer dreister. Sie verweigerten nicht nur, neue Rechte zu gewähren, die minimalen alten Rechte gingen ihnen noch zu weit. Uhland hielt dagegen:
„Es wird kein Haupt über Deutschlandland leuchten, das nicht mit einem vollen Tropfen demokratischen Öls gesalbt ist.“
(Rede am 22.1.1849 in der Nationalversammlung).
Uhland mahnte vergeblich. Im Gegenteil: Die Reaktion strangulierte mit Gewalt alle Einheits- und Freiheitsbestrebungen. An eine demokratische Mitwirkung durch das Volk oder eine Mitsprache bei der Besetzung der höchsten politischen Ämter war nicht zu denken. Zensur und Unterdrückung wurden verschärft.
Für ein wahres Königtum
„Von aller Herrschaft, die auf Erden waltet,
Und der die Völker pflichten oder frönen,
Ist eine nur, je herrischer sie schaltet,
Um so gepriesener selbst der Freiheit Söhnen:
Es ist das Königtum, das nie veraltet,
Das heil´ge Reich des Wahren, Guten, Schönen;
Vor dieser unbedingten Herrschaft beugen
Der Freiheit Kämpfer sich und Bluteszeugen.“(Aus dem Nachlass)
Das freie Volk beugt sich aus freiem Willen natürlich nur einem gewählten König.
Für Großdeutschland
Das Paulskirchen-Parlament von 1848 hatte eine starke großdeutsche Fraktion, die alle Deutschen unter einem Dach vereinen wollte.
Ich kenne, was das Leben euch verbittert,
Die arge Pest, die weitvererbte Sünde;
Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe,
Gesetzlich frei, volkskräftig, unzersplittert;(aus: „An die Bundschmecker 1816“)
Eine „kleindeutsche Lösung“ ohne Österreich und eine damit drohende künftige preußische Erbmonarchie lehnte Uhland ab:
„Ich gestehe, einmal geträumt zu haben, daß der großartige Aufschwung der deutschen Nation auch bedeutende politische Charaktere hervorrufen werde, und daß hinfort nur die Hervorragendsten an der Spitze des deutschen Gesamtstaates stehen werden. Dies ist nur möglich durch Wahl, nicht durch Erbgang…. Die Revolution und ein Erbkaiser – das ist ein Jüngling mit grauen Haaren…
Ich lege noch meine Hand auf die alte offene Wunde, den Ausschluß Österreichs. Ausschluß, das ist doch das aufrichtige Wort; denn wenn ein deutsches Erbkaisertum ohne Österreich beschlossen wird, so ist nicht abzusehen, wie irgend einmal noch Österreich zu Deutschland treten werde. Auch ich glaube an die erste Zeit erinnern zu müssen. Als man Schleswig erobern wollte, wer hätte da gedacht, daß man Österreich preisgeben würde?
Als die österreichischen Abgesandten mit den deutschen Fahnen und mit den Waffen des Freiheitskampfes in die Versammlung des Fünfziger Ausschusses einzogen und mit lautem Jubel begrüßt wurden, wem hätte da geträumt, daß vor Jahresablauf die österreichischen Abgeordneten ohne Sang und Klang aus den Toren der Paulskirche abziehen sollten? Die deutsche Einigung soll geschaffen werden… Eine wahre deutsche Einigung muß alle deutschen Ländergebiete zusammenfassen.“
(Rede vom 22.1.1849 im Frankfurter Parlament)
Realpolitik
Wer war nun dieser Uhland? Wo ordnet man ihn ein? Klar ist, dass er sich als Politiker und Dichter unmissverständlich patriotisch geäußert hat. Alle Versuche, ihn ausschließlich als Dichter oder gar als liberalen Politiker darzustellen, entsprechen nicht den Tatsachen.
Solange sich die Möglichkeit ergab, arbeitete er als Jurist legal in Parlamenten und Reformgremien. Uhlands zwangsläufiger Verzicht auf radikalere Forderungen nach einer Begrenzung der Amtszeit des Staatsoberhauptes, einer Volksbewaffnung oder der Abschaffung des Adels hin zu einer vorläufigen Kompromisslösung eines Staats mit einem an die Volksrechte gebundenen Staatsoberhauptes aus dem Adel spiegelte jedoch die wahren Machtverhältnisse in Deutschland wider. 1849 kam die Realpolitik an ihr zwangsweises Ende.
Sein Publikum verstand ihn wohl, wenn er dichtete:
„Man rettet sich gern aus trüber Gegenwart,
Sich in das heitere Gebiet der Kunst,
Und für die Kränkungen der Wirklichkeit
Sucht man sich Heilung in des Dichters Träumen.
Doch heute – wen vielleicht der Bühne Spiel
Verwundert, der gedenke, sich zum Troste,
Welch Fest wir wahr und wirklich heute begehn!
Da mag er sehn, für was die Männer sterben.“(aus: Prolog zu dem Trauerspiel „Ernst Herzog von Schwaben“)
Von Anfang an zweigleisig
Uhland agierte jedoch schon von Anfang an zweigleisig. Neben der Realpolitik standen seine dichterischen und volkskundlichen Arbeiten, die man als „metapolitisch“ bezeichnen kann:
Nach dem Scheitern von 1848 und der erstarkenden Reaktion blieb nur, sich neu auszurichten und mit der mythischen Vergangenheit gegen die triste Gegenwart zu verbünden. Die Ergebnisse aus seiner Beschäftigung mit der Geschichte und dem Volk hielten sowohl den mittlerweile allzu braven Bürgern, als auch den Herrschenden einen Spiegel vor. Auf evolutionärem Wege sollte nunmehr das Bewusstsein allmählich verändert werden und dem Volk der Platz zukommen, der ihm zustehen musste.
Ich sehe, daß du wenig weißt
Von Schwung und Schöpferkraft.»
Ich lobe mir den stillen Geist,
Der mählich wirkt und schafft.«Der echte Geist schwingt sich empor
Und rafft die Zeit sich nach.»
Was nicht von innen keimt hervor,
Ist in der Wurzel schwach.(aus: Gespräch, 1816)
Veränderungen sah er nur noch langfristig:
„Wohl wird ich´s nicht erleben,
Doch an der Sehnsucht Hand
Als Schatten noch durchweben
Mein freies Vaterland.“(aus dem Gedicht „Wanderung“)
Tief verankert im Volk
Uhland erforschte die deutsche und artverwandte Mythologie. Mit Schwerpunkten auf der Zeit der Germanen und dem Mittelalter versuchte er, den Wesenskern des deutschen Menschen freizulegen. Mythen, Sagen, Bräuche – alles wurde akribisch gesammelt und gesichtet.
In zahllosen politischen Versammlungen, aber auch zu offiziellen Anlässen, wie etwa bei der Verkündung des Baden-Württembergischen Grundgesetzes 1819, wurden Uhlands Werke präsentiert. Der Volksdichter war in Deutschland allgegenwärtig. Sein metapolitischer Einfluß war unverkennbar. Die Deutschen kannten und schätzten ihren Uhland. Sie lasen, hörten und interpretierten ihn in seinem Sinne.
Das Volk als Kernbestand
Ohne das Volk, aus dem die erwählten Regenten kommen, sind jene nichts. Das Volk ist die eigentliche Kraftquelle. Die Herrscher müssen sich ihren Platz erdienen und ihre Macht zum Nutzen des Ganzen einsetzen. Wer das Volk führt, muss ihm Respekt zollen und sich stets seiner Verantwortung ihm gegenüber bewusst sein. Indes verhält es sich seinem König gegenüber loyal.
Dem Volk voraus geht eine unendliche Kette an Ahnen, es ist eine Schicksalsgemeinschaft gleicher Art. Diese Art zu erhalten, seine Bräuche zu pflegen und die Kontinuität zu wahren ist Pflicht aller.
Die Deutschen ab der Zeit um 1813 hatten ein wachsendes feines Gespür für das, was Uhland ihnen darbot. Uhlands Metapolitik war zwar kein Ersatz für Realpolitik, sie entfaltete aber eine eigene Wirkmacht.
Es gibt vieles zu entdecken
Mag der Leser dieser Zeilen selbst auf Entdeckungsreise gehen und neben seinen oftmals vertonten Gedichten vor allem auch seine Dramen, wie jene über den Herzog Ernst von Schwaben, Ludwig den Baier oder Otto von Wittelsbach, sich erschließen. Hinzu treten seine Abhandlungen über die deutschen Volkslieder und seine Schriften aus der Sagengeschichte der germanischen und romanischen Völker, wie etwa die „Nordische Sage“, der „Mythos von Thor“, die „Ältesten Spuren der deutschen Göttersage“ sowie „Zur romanischen Sagengeschichte“.
In reichem Maße bot sich hier ein Stoff für seine Dichtkunst, die aus diesen Quellen schöpfte, aber stets was Neues erschuf.
Nicht korrumpierbar
Die Herrschenden versuchten, ihn mit Ehrungen zu umschmeicheln. Uhland erkannte die Absicht und verzichtete, neben dem bayerischen „Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst“, auf die höchste Auszeichnung, den „Pour le Mérite“:
„Er verpflichtet mich, jetzt schon unrückhaltig zu sagen, daß ich mit literarischen und politischen Grundsätzen, die ich nicht zur Schau trage, aber auch niemals verleugnet habe, in unlösbaren Widerspruch geraten würde, wenn ich in die mir zugedachte, zugleich mit einer Standeserhöhung verbundene Ehrenstelle eintreten wolle. Dieser Widerspruch wäre umso schneidender, als nach dem Schiffbruch nationaler Hoffnungen, auf dessen Planken auch ich geschwommen bin, es mir nicht gut anstände, mit Ehrenzeichen geschmückt zu sein… “
(Brief an Alexander von Humboldt vom 2.12.1853)
Ein bleibendes Vermächtnis
Ludwig Uhland war ein deutscher Patriot, der im Rahmen seiner Möglichkeiten sowohl als Politiker, als auch metapolitisch tätig war. Er ist eindeutig einer neuen Rechten zuzuordnen, die im schroffen Gegensatz zur alten Reaktion stand. Seine Gedanken kreisten um ein geeintes Deutsches Volk in einem Großdeutschland mit einer volksgemäßen, höchstmöglich demokratischen Ordnung, allerdings auch mit einer Hierarchie, an deren Spitze die Besten gewählt werden sollten.
Während seine politischen Aktivitäten an den gegebenen Verhältnissen scheiterten, wurde er als Volksdichter und Volkskundler unsterblich.