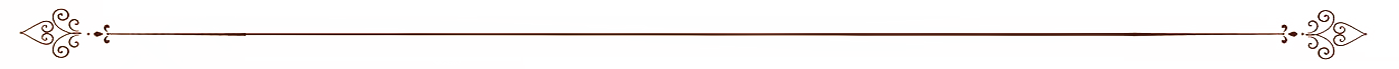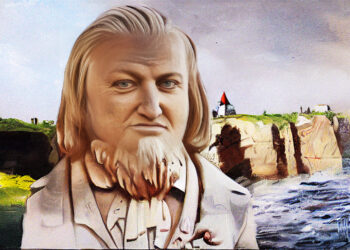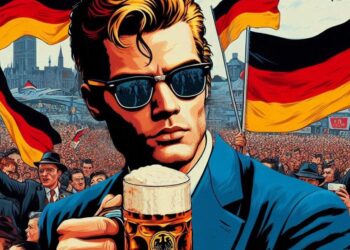Wenn alle zwei Jahre wieder beim aktuellen Fußball-Event die Frage nach der deutschen Flagge diskutiert wird, wird klar, dass das deutsche Volk immer noch keine gesunde Position dem Patriotismus gegenüber hat. Das nationale Selbstbild bleibt, auch wenn es an den Rändern in unverhohlenen Hass oder romantische Idealisierung umschlagen mag, gestört. Relevant und politisch bedeutsam ist die große Masse zwischen diesen Rändern. Und dabei sehe ich seit wenigen Jahren einen Trend, der Hoffnung weckt.
Deutschland schwimmt in Memes: Jules
„Jules“ ist ein typischer Gen Z- YouTube- Kanal, der Videos über die einzige für diese Generation noch relevante Kultur macht: Internetkultur. In animierten Videos beschreibt er z.B. den katastrophalen Niedergang der Spielefirma E.A., der skurrile Aufstieg von NFTs oder die Panik vor Artikel 13 im Internet. Alle zwei Sekunden blitzt ein Meme, was die ohnehin lächerlichen Geschehnisse im Video noch mehr ins Lächerliche zieht und Jules referiert stets in ironisch-lehrerhafter Manier über die wahnwitzigen Blüten des Internets. Gute Unterhaltung, aber politisch komplett apathisch. So weit, so erwartbar. Es geht hier schließlich um YouTube.
Seit etwa einem Jahr fiel mir allerdings ein Schlenker in seiner Themenwahl auf; vermehrt betrachtet Jules mit seinen Videos insbesondere Aspekte deutscher (Internet-) Kultur, was vor allem deshalb bemerkenswert ist, da im Internet mehr als sonst irgendwo nationale und kulturelle Grenzen verschwimmen. So referierte Jules etwa über deutsche Memes und führt aktuell eine Serie von „Bundesländern in einer Nussschale“ fort. Das meistgeklickte Video seines Kanals heißt „Ein Video über Deutschland“ und geht.. naja, um deutsche Kultur eben, sehr modernistisch (die Erwähnung des Kaiserreichs oder Kants sucht man hier vergebens), aber wie immer unterhaltsam und getränkt mit Memes. Jedes noch so alte Ereignis wird von einer Internetreferenz untermalt, jeder historische Fakt wird zur Pointe. Jules nimmt dabei aber immer eine positive, interessierte Perspektive gegenüber seinem Land ein. Die deutsche Persönlichkeit stellt er stereotyp, aber keineswegs nur negativ da. Deutsche Geschichte reduziert er erfrischenderweise nicht nur auf das Dritte Reich, sondern sieht auch die Nazi-Zeit als eben nur ein Puzzlestück unter vielen, und zieht dies genauso humoristisch und internet-ironisch ins Lächerliche wie die andere.
Eine fast populistische Kritik kommt in den letzten zwei Minuten des Videos, wo Jules wenig vage Missstände in Deutschland formuliert. Dabei nennt er neben Klassikern wie überbordender Bürokratie oder „Neidkultur“ eben auch nationalen Selbsthass und eine Politik, die Geld für „Radwege in Bangladesch“ ausgibt, aber kein Geld für eine moderne Ausstattung heimischer Schulen hat und in dem es möglich ist, dass „[…] Du deine Tochter ab Abend zu einer Geburtstagsfeier verabschiedest, und du morgens um fünf von für immer lebensverändernden Polizeisirenen geweckt wirst“. Diese dann doch sehr konkreten Beispiele beendet er mit der Metapher des Frosches, der im immer heißer werdenden Wasser langsam vergeht, ohne es selbst zu merken.
Jules nimmt nach anderthalb Stunden des vorsichtig-humoristischem Patriotismus in den letzten Minuten eine kritische Position ein, in dem er ausschließlich und klar deutsche Interessen vertritt; kein Wort von den üblichen Verdächtigen „Sexismus“ oder „Islamophobie“, die sonst bei Kritik an Deutschland nirgendwo fehlen dürfen. Und dennoch: dieses Video ist das meistgeklickteste aus seinem Kanal. Die Jugend weiß es vielleicht noch nicht, aber die Jugend will Patriotismus.
Geschichte erleben: Das Deutschlandmuseum
Ein ähnliches Gefühl wie beim Schauen dieses Videos empfand ich, als ich jüngst auf einer Berlin-Reise das Deutschlandmuseum besuchte. Dieses ist ein erst zwei Jahre altes Museum am Potsdamer Platz, was bereits einige namenhafte Tourismuspreise erhielt. Und dies nicht ohne Grund- das Museum ist wirklich immersiv gestaltet. Jedes Zimmer stellt eine Epoche deutscher Geschichte da, indem der ganze Raum zur Kulisse erhoben wird. Man schreitet zwischen den Bäumen des Teutoburger Waldes, durch Luthers Schreibzimmer oder einen Schützengraben des ersten Weltkriegs. Station für Station geht man durch deutsche Geschichte, die zwar sehr verkürzt, dafür aber für alle, vor allem für Kinder, verständlich dargestellt wird.
Auch hier bekommen die „12 Jahre“ Erwähnung als eine von vielen Zeitepochen, durch die das deutsche Volk gegangen ist. Sicher- der zweite Weltkrieg und die Nazi-Zeit sind eine einzige düstere Gasse, in der inhaltlich wie temporär unzusammenhängende Zitate, untermalt von gruseliger Musik und dem rhythmischen Marschieren von Soldaten, abgespielt werden, aber es ist eben nur ein Raum von vielen, der vielleicht besonders schwarz, aber nicht besonders groß ist.
Auch dem Museum kann man eine vorsichtig-positive Einstellung zu Deutschland unterstellen. Es werden verschiedene wichtige deutsche Persönlichkeiten, wie Arminius, Otto der Große und Willy Brandt eindeutig positiv dargestellt. Und es wird immer eine eindeutig deutsche Perspektive eingenommen. Natürlich wird auch das Deutschlandmuseum nicht eindeutig patriotisch. Es informiert, fasst Fakten zusammen und gestaltet Räume so realistisch wie möglich. Aber wer aus dem letzten Raum wieder aus dem Museum heraussteigt, der ist sich doch, so meine ich beobachtet zu haben, in leicht pathetischer Weise seiner Herkunft positiv bewusst.
Im Tal der Nibelungen
Und noch ein drittes Mal ereilte mich dieses Gefühl, und zwar beim Schauen des Fantasyfilmes „Hagen- Im Tal der Nibelungen“, der letzte Jahr herauskam. Dabei wurde der Roman von Hohlbein (1986) verfilmt, welcher auf der uralten Nibelungensage basiert. Diese zum nationalen Mythos erhobene Erzählung wurde schon einige Male verfilmt; im Stummfilm Die Nibelungen (1924), in der italienischen Fassung Sigfrido (1958) oder der albernen Parodie Siegfried (2005) setzte man sich immer wieder in unterschiedlichem Grad der Originalgetreue mit dieser Geschichte auseinander.
Diese filmische Neuerzählung versucht nun, die Balance zwischen altertümlichen und modernen Elementen stets zu halten- es ist eben kein historischer Film, indem noch die letzte Rocknaht und der letzte Stein im Burgtor historisch korrekt ist, sondern die moderne Interpretation einer alten Sage zu Entertainment-Zwecken. Wichtig ist dabei vor allem, dass es schön aussieht und gut klingt. Die Filmfiguren sprechen modernes, fast umgangssprachliches Hochdeutsch, was den Film verständlicher und die Dialoge kürzer macht. Eine Figur trägt stets eine Art T-Shirt mit Hose, ein großer Gegensatz zu seinen Mitstreitern in Kutte und Rock, was die urhistorische Atmosphäre des Films bricht. Damit hebt sich diese Verfilmung von vielen seiner etwas staubigen Vorgängern ab, die alles auf die historische Karte setzen, damit aber nur wenige Normalbürger zu entzücken vermochten.
Auch ist ein Kernkonflikt zwischen Loyalität und Traditionalität und Selbstenthemmung und Modernität einer, der durchaus auf die heutige Zeit übertragen werden kann. Lohnt es sich, so fragt der Film, einen mächtigen erfolgreichen Krieger am Königshofe zu haben, der aber alle Sitten missachtet, die Beziehungen durcheinanderbringt und den König nicht respektiert? Es fällt nicht schwer, aktuelle Parallelen zu ähnlich gelagerten Dilemmata zu ziehen.
In Kinematographie, Bühnenbild und Kostüm gibt der Film alles, um den Standards moderner Fantasyfilme wie „Game of Thrones“ mitzuhalten. Natürlich erreich ein Film dieses Kalibers keine Hollywoodstandards, aber es wurde dennoch einen stabilen, kleinen deutschen Bruder geschaffen, der sich durchaus neben berühmte Fantasyklassiker stellen kann. Und es wurde eben nicht irgendeine Geschichte als Grundlage gewählt, nicht ein anderes der über 200 Werke von Hohlbein, sondern die alte deutsche Nibelungensage.
Der Zuschauer verlässt den Kinosaal mit dem Gefühl, einer spannenden Fantasygeschichte beigewohnt zu haben, die in Deutschland spielt, ohne ein Heimatfilm zu sein, der sich propagandistisch aufdrängt. Wer weiß, vielleicht keimt in einigen Zuschauern auch dann der leise Wunsch, sich dieses „Burgund“ mal anzuschauen, in dem die Handlung spielt, die Burg sah ja schon ganz cool aus, Deutschland ist ja doch nicht so langweilig…
Fazit
Nun, all diese Phänomene halten sich wie gesagt mit eindeutigen Patriotismusbekundungen zurück, alle aber betrachten sie Deutschland und seine Geschichte und Kultur aus einem eindeutig wohlgesonnenen Blickwinkel. Keine dieser Urheber sind dezidiert rechts oder auch nur dezidiert politisch und genau das ist eine sehr gute Nachricht. Das Overton-Fenster ist immer noch weit, weit links, aber nun kann man zumindest von rechts hineinspähen, um ein bisschen über deutsche Kultur zu reden. Und dies eben auch ohne eine direkt politische Absicht, sondern einfach nur, weil es Spaß macht. Insbesondere der Hinweis, dass die Angebote auch für Jugendliche bzw. Kinder zugänglich sind, lässt Hoffnung aufkeimen für eine langsame Renaissance des deutschen Patriotismus.