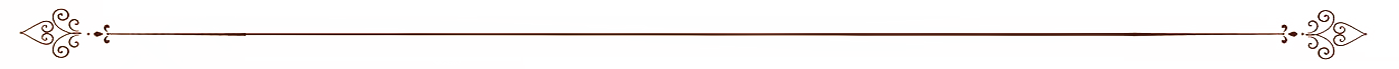Es ist unbestritten, daß Sir Arthur Conan Doyle der Welt kriminologisch weit voraus war. Er hat der Verbrechensbekämpfung einen systematischen, wissenschaftlichen Ansatz verliehen, der vor „Sherlock Holmes“ unbekannt war. Und auch in „Die Maracot-Tiefe“ zeigt sich, wie weit Doyle seiner Zeit voraus war. Dieses Spätwerk aus dem Jahre 1929 nimmt mit beeindruckender Präzision die postmoderne Sinnkrise vorweg. Sie ist ein spiritueller Zeitraffer der 100 Jahre, die dem Tod ihres Verfassers folgen sollten.
Zahlreiche Belege für die Echtheit der Geschichte?
Das Werk dreht sich um einen wissenschaftlich motivierten Tauchgang zum Meeresgrund, der durch einen Sturm ein übles Ende nimmt. Das ist nun nicht so außergewöhnlich, doch ihren besonderen Wert erhält die Geschichte durch Doyles Art, die Ereignisse zu schildern: Der eigentliche Erzähler nimmt sich fast völlig zurück.
Die Geschichte wird nicht auktorial-allwissend wiedergegeben, sondern mühsam aus Briefen, Funksprüchen, Logbucheinträgen und einer Flaschenpost rekonstruiert, die vom Erzähler nur zusammengetragen und in Buchform herausgegeben wurden. Ganz so, wie es bei einer echten Rekonstruktion eines solchen Unglücks wohl laufen würde.
Sowohl Maracot, als auch dem Ich-Erzähler Mr. Headley, von dem der einleitende Brief und die Flaschenpost stammen, attestiert Doyle einen hervorragenden Ruf in der wissenschaftlichen Welt, zu dem auch preisgekrönte Essays zählen – wer jetzt noch an der Glaubwürdigkeit zweifelt, muß schon ein arger Querdenker sein. Und was hätte der Leser auch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts tun sollen, wo nicht jeder einen Rechner im Wohnzimmer hatte, vermittels dessen er das Weltnetz befragen und feststellen konnte: Diese Leute und ihre wissenschaftlichen Arbeiten gibt es gar nicht!
Indem er seine Geschichte auf so viele unabhängige Quellen stützt, erhält sie also eine ausgesprochene Glaubwürdigkeit, denn die Quellen können ja nicht alle falsch liegen – auch nicht, wenn Doyle sie alle eigens für diese Geschichte erfunden hat.
Mit Haut und Haaren der Wissenschaft gewidmet
Anlaß für den Tauchgang in die Tiefsee ist Doktor Maracots Theorie, der Wasserdruck wachse nicht gemäß des Pascalschen Gesetzes linear mit steigender Tiefe an, sondern nähere sich sukzessive einer Konstanten. Als Indizien dafür führt er die fragilen Lebensformen an, die man aus der Tiefsee fischt, und die durch den Druck nicht „flach wie eine Scheibe gepreßt worden“ sind (Zitat von Sir Arthur Conan Doyle). Zwanghafter Wissenschaftler, der er ist, will er zusammen mit Mr. Headley in einer Metallkiste hinabsteigen, um seine Theorie zu überprüfen. Und das in Tiefen, in denen der Druck nach gängiger Lehrmeinung diese Kiste zerdrücken wird wie eine Plastikflasche – der Mann hat Vertrauen in seinen Verstand!
Schmackhaft macht Maracot dieses Unterfangen seinem jungen Begleiter mit den Worten: „Sollten sich meine Berechnungen jedoch als falsch erweisen… nun, Sie sagten bereits, daß niemand auf Ihre Unterhaltszahlungen angewiesen ist. Wir sterben dann in einem gewaltigen Abenteuer.“ So läßt sich Mr. Headley anstecken vom Enthusiasmus des alten Maracot, „der sein Leben mit Haut und Haaren der Wissenschaft gewidmet hat.“ (Zitat von Sir Arthur Conan Doyle)
Die Berechnungen des Doktors erweisen sich nicht als falsch, dafür wird jedoch von einem Tiefseemonster die Stahltrosse gekappt, an der sich die beiden zusammen mit dem Ingenieur Bill Scanlan hinablassen in eine noch nicht kartographierte Untiefe – die Maracot-Tiefe, wie sie nach dem Unglück genannt werden soll. Und damit beginnt die wissenschaftliche Erforschung dieser Untiefe.
Auf dem Meeresgrund leuchtet es
Auf dem Meeresgrund angekommen, stellen die drei Abenteurer fest, daß dieser selbstleuchtend ist. Bemerkenswert daran und an all den anderen naturwissenschaftlichen Absonderlichkeiten ist, daß Doyle sich um eine vernünftige Erklärung bemüht. So käme das Leuchten des Meeresgrundes von der phosphoreszierenden Verwesung der Tiere, die in rauhen Scharen zu ihm hinabsinken.
Man kann hier als moderner Leser leicht lachen ob dieser völlig absurden Erklärung, genau wie man sich über die naturphilosophischen Untersuchungen des Thales nur erheitern kann – Wasser als der Stoff, aus dem alle Materie zusammengesetzt ist. Das kann ja nur einem besonders naiven, ahnungslosen Verstand entsprungen sein. Es ist doch völlig klar, daß es Atome sein müssen, aus denen unsere Materie besteht. – Ja, klar ist das schon, nämlich heute.
Doch damals waren diese Aussagen vermutlich nicht so dumm und abwegig, wie sie uns heute erscheinen. Damals wußte man nicht, was richtig ist, und wenn man im Geiste unserer Ahnen über den Horizont hinausdenken will, muß man irgendwann einfach einmal eine Aussage treffen, die auch grandios falsch sein kann. Selbst die Falsifizierung derselben ist noch besser, als sich gar nicht um eine Weiterentwicklung bemüht zu haben.
Dieses wissenschaftliche Denken in Ursache und Wirkung ist ein wichtiger Teil von Doyles Schaffen, das er auch in seinen Abenteuergeschichten konsequent anwendet. Für den erfolgreichen Tauchgang zum Meeresgrund bedarf es einer naturwissensschaftlichen Erklärung – also liefert Doyle eine. Sie mag falsch sein, aber in der Hochzeit von Industrialisierung und Naturwissenschaften, in der Doyle lebte, ist es nicht statthaft, zurückzufallen in Erklärungsmodelle wie „Magie“ oder „Gott“.
Hochtechnologie ermöglicht menschliches Leben in der Tiefsee
Dazu gehört auch die Entdeckung des versunkenes Atlantis, bei dessen Bewohnern Doktor Maracot und seine Begleiter aufgenommen werden. Atlantis wurde gemäß Doyles Schilderung für die Unmoral seiner Bewohner vom Erdboden getilgt. Nur ein reicher Antlantiker, Warda, sah die göttliche Strafe voraus und baute mittels Hochtechnologie eine Festung, die es ihm und seinen Getreuen ermöglichte, den Untergang Atlantis‘ zu überleben und fortan am Meeresgrund zu überdauern.
So fortgeschritten war diese alte Technologie, daß ihre Besitzer Honig und laut Maracots Vermutungen auch alle anderen Substanzen durch überlegene Chemie synthetisch herstellen können.
Luftschleusen ermöglichen das Verlassen der Festung in Taucheranzügen aus einem speziellen Glas, das so hart ist, daß es dem Wasserdruck standhält, und in dem auch die Flaschenpost versteckt wird, von der bereits die Rede war. Die Kommunikation der Abenteurer mit den Antlantikern findet mittels eines Telepathiebildschirms statt – ein weiteres, rein technisches Gerät, das mit Hexerei nichts zu tun hat.
Es ist charakteristisch für Doyle, daß er Sherlock Holmes nicht einmal eine einheitliche Haarfarbe zuweist, dafür aber jedes logische Detail bedenkt. Oder hätten auch andere Autoren sich damit aufgehalten, zu erklären, wie man auf dem Meeresboden Honig herstellt? Oder ein Gerät zur telepathischen Übertragung von Gedanken erfunden, um die Sprachbarriere zu überwinden? Ich vermute: Die meisten hätten sich gedacht: „Merkt ja eh keiner.“ Beziehungsweise: Sie hätten es selbst nicht gemerkt. Doyle hingegen ist bestrebt, alles wissenschaftlich zu erklären. Nichts fällt vom Himmel; alles bedarf einer fundierten Erklärung. Doyle hat sich nicht weniger als Doktor Maracot „mit Haut und Haaren der Wissenschaft gewidmet“.
Und plötzlich läßt er die Wissenschaft fallen
Umso interessanter ist es, daß im letzten Drittel des Romans mit Kapitel VI ein übernatürliches Element Einzug erhält. Denn die Atlantiker fürchten einen alten Gott, der sich just wieder in Atlantis einfindet, als Maracot mit seinen beiden Gefährten in dessen Tempel eindringt.
Der Gott stellt sich als Baal-sepa vor; der Herr des dunklen Gesichts. Bereits körperlich weit über zwei Meter groß und von perfekten athletischen Proportionen, kann er Gedanken lesen, sowie den Körper anderer kontrollieren; Zeit und Alter können ihm nichts anhaben und darüber hinaus hat er die Fähigkeit, sich zu teleportieren.
Er konstatiert, daß er gar nicht sterben kann, selbst wenn er wollte, und „falls [er] doch jemals sterben sollte“, so müsse „ein stärkerer Geist als der [s]eine […] die Ursache gewesen sein“ (Zitat von Sir Arthur Conan Doyle).
So übermächtig erscheint der Gott, daß die Atlantiker sich bereitwillig in ihr Schicksal fügen wollen, und auch Headley und Scanlan alle Hoffnung fahren lassen. Denn wie soll man ein solches Geschöpft auch besiegen? Die Methode der Wissenschaft, jene, die ihnen bisher so gute Dienste erwiesen hat, erweist sich als völlig nutzlos. Moderne Waffen, wie Pistolen, können dem Gott nichts anhaben. Das logische, formale und damit auch langsame Denken ist machtlos gegen einen Gegner, der jedem Gedankengang mühelos folgen und ihn entsprechend kontern kann.
Welche Rettung hat sich Sir Arthur Conan Doyle eingedenk dieses Szenarios ausgedacht? Es ist ein deus ex machina im eigentlichen Sinne: Doktor Maracot, der Mann der Wissenschaft, betet zum geistgewordenen Warda, dem einstigen Gegenspieler Baal-sepas. Von diesem mit engelsgleichen Fähigkeiten ausgestattet, reicht seine Macht nun hin, Atlantis vor einem weiteren Untergang zu retten. Der Herr des dunklen Gesichts ist vernichtet. Ein Wort aus Maracots Munde war genug. Wo die Wissenschaft nicht aus noch ein wußte, genügte ein Gebet.
Nur ein Ausreißer?
Als bloßen Zufall möchte ich dieses Arrangement der Maracot-Tiefe nicht abtun. Denn auch in Doyles übrigem Spätwerk finden sich übernatürliche Einflüsse. So gibt es um Professor Challenger eine nicht gerade kurze Geschichte, die sich ganz dem Spiritismus widmet. Und der letzte Sammelband um Sherlock Holmes, das Buch der Fälle, bietet manchmal Lösungen, die man streng genommen nicht mehr als natürliche Erklärung akzeptieren dürfte. Etwa „Der Mann mit dem geduckten Gang“, dem folgendes Zitat entnommen ist:
„Stellen Sie sich vor, Watson, die Materialisten, die Sinnlichen, die Mondänen würden allesamt ihr wertloses Leben verlängern. Die Spiritualisten würden sich dem Ruf nach Höherem nicht verweigern.“
Klingt das noch nach dem abgeklärten Privatdetektiv, wie man ihn aus „Die Abenteuer des Sherlock Holmes“ kennt? Hat sich Dyoles Einstellung im Laufe der fünfunddreißig Jahre, die zwischen dem Erscheinen der beiden Sammelbände liegen, wirklich so stark gewandelt?
Zu obigem Zitat des Sherlock Holmes paßt auch, was der Herr des schwarzen Gesichts über seine Unsterblichkeit sagt:
„O Sterbliche, betet niemals darum, vom Tod befreit zu werden. Das Sterben mag furchtbar sein, aber das ewige Leben übertrifft es noch an Schrecken. Immer weiterzuleben, während um einen herum die endlose Prozession der Menschheit vorbeizieht, auf ewig am Wegesrand der Geschichte zu sitzen und ihren Verlauf zu verfolgen, wie sie ständig voranschreitet und einen selbst zurückläßt.“
Krasser Gegenpol dieser trüben Worten sind jene, die den Verlauf der Geschichte nicht nur verfolgen, sondern ihn aktiv mitgestalten. Sie setzen sich bewußt der Gefahr des Todes aus, um ihr Leben bis zur Neige auszukosten; ihm einen Sinn zu verleihen. Und hat man diesen Sinn, so verliert auch der Tod seinen Schrecken.
Der Herr des schwarzen Gesichts lebt; das tut er seit Jahrtausenden. Doch einen Genuß hat er nicht daran. Er sitzt am Wegesrand und sieht zu, wie alles vorbeizieht. Und auch der moderne Mensch vegetiert ohne höheres Ziel sinnlos vor sich hin, bis er dann endlich verstirbt. Wirklich gelebt hat er nie.
Der Mensch will keine Wissenschaftler – er dürstet nach Propheten
Viele versuchen, die Moderne mit Sinn zu erfüllen, indem sie zu neuen, noch unverbrauchten Göttern flüchten. Sei es „Die Wissenschaft“ als monolithische Einheit, der sie nun hörig sind, oder der Götze der Klimareligion, den die Jugend so inbrünstig anbetet. Obwohl ihre Anhänger nichts davon verstehen und nur auswendig gelernte Phrasen wiederkäuen, sind sie von ihrem blinden Fanatismus kaum abzubringen. Es erinnert an das Kirchenlatein des Mittelalters – man betet verständnislos nach, was der Pfaffe vorsagt. Experten werden zu Propheten, deren Wort gleich dem eines Gottes über jeden Zweifel erhaben ist.
Die Geschichte über die Maracot-Tiefe hätte nie stattgefunden, wenn der Doktor seine Passion der Vernunft geopfert und nicht hinab zum Meeresgrund gestiegen wäre. Wenn er beim Anblick des Tiefseemonsters nicht an seine wissenschaftliche Mission, sondern an sein Leben gedacht und den Befehl zum Auftauchen gegeben hätte.
Doch warum fühlt sich diese Option so langweilig an? Vernunft allein ist hohl und leer. Es fehlt ihr an Lebenskraft – am thymotischen Element, das uns mit Begeisterung erfüllt. Sie mag uns Einsicht und Wirklichkeitssinn liefern, doch Feuer hat daran noch niemand gefangen. Kein Idealist ist vernünftig.
Wir haben unsere menschliche Natur lange genug mit Füßen getreten und verleugnet, aber früher oder später wird der Punkt erreicht sein, ab dem wir uns nicht mehr durch Ersatzhandlungen ablenken können von dem, was wirklich nottut. Eine lebensbejahende Rechte muß den thymotischen Teil der menschlichen Seele bedienen können. Sie muß dem Irrationalen Raum lassen und die Möglichkeit geben, den individuellen Pathos als Element eines größeren Ganzen auszuleben.
Kein Verfassungspatriot hat sich je für die BRD geopfert.
Aber vielleicht gibt es einst eine Rechte, deren Leuchtfeuer jemand mit dem eigenen Lebensfunken bereitwillig entzündet.