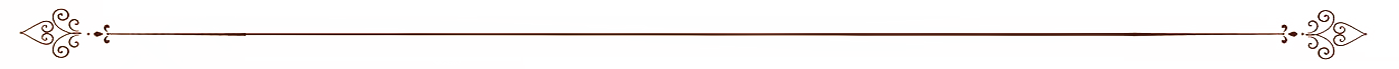Aus dem weiten und tiefen Ozean kultureller Hoch- und Höchstleistungen sticht Ludwig van Beethovens Gesamtwerk hervor wie nur ganz wenige neben ihm. Dabei erzielte der Mann aus Bonn eine zeitlose, identitätsstiftende Wirkung, die bis heute von ungebrochener Strahlkraft ist. Kaum ein Ereignis, bei dem sich Europäer nicht auf ihn berufen; dabei beflecken selbsternannte Demokraten gerne ausgerechnet das Grab des Mannes, der nicht nur vor Ideenreichtum und operativer Präzision nur so strotzte, sondern der auch stets enorm selbstbewusst auf seine Wurzeln verwies und den Stolz auf sich selbst gerne demonstrierte. Nein, sich klein zu machen, das war ganz gewiss nicht Beethovens Sache. Eine derartige Revolution seines Genres vermochte nur eine Persönlichkeit zu entfachen, deren emotionale und rationale Seiten extrem ausgeprägt waren. Sie entluden sich in Leistungen, die nicht überschätzt werden können.
Das jedoch, die Relativierung seiner Leistungen einerseits (der größte Musiker aller Zeiten darf natürlich kein europäischer Mann sein) und die Kolorierung seiner Haut ins Schwarze andererseits (zuletzt versuchten neolinke Fanatiker, ihn als Afrikaner zu konstruieren, auch begünstigt dadurch, dass Beethoven dank seines dunklen Teins tatsächlich „der Spanier“ genannt wurde), waren verzweifelte Versuche, der deutschen Geschichte eine ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten zu entreißen. Sie scheiterten kläglich.
Ludwig van Beethoven wird auch 200 Jahre nach seinem Tod als Gipfel seiner Zunft gefeiert, ist der mit Abstand meistgespielte Komponist der Klassik. Dabei ist er bei Hörern unterschiedlicher Couleur – Publikum, Experten, Snobs – gleichermaßen beliebt. Neben der inzwischen nur noch teilelitären Welt abendländischer Konzerthäuser trällert man seine Melodien und Refrains auch in Hinterhöfen, auf abseitigen Gassen und entlegenen Pfaden. Seine Themen – wie etwa jene aus den Symphonien 5 und 9 – sind es, die vom Amazonas bis zum Himalaya jedes Kind kennt. Warum genau gilt der deutsche Komponist nach wie vor als der Musiker schlechthin? Worauf fußt die Tatsache, dass ein Künstler neben dem bloß quantitativen Wert, von den Massen beklatscht zu werden, auch unter den anspruchsvollsten Kennern des Fachs ungebrochen höchste Anerkennung genießt?
Elitäre Urgewalt
Weder der politische Missbrauch noch die Endlosschleife seiner Werke im „Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit“ (Walter Benjamin) konnten der Aura, die die Person Beethoven und seine Kunst umgibt, etwas von ihrem Zauber nehmen. Beethoven, das ist der Inbegriff des elitären, mystisch überhöhten Intellektuellen. Diese Seite erscheint abgehoben und aus der Perspektive desjenigen, der sich klassischer Musik nähert, fast pseudo-intellektuell.
Aber erstens entpuppen sich sogar weite Teile des sogenannten Spätwerks, dessen Verständnis Snobs gerne exklusiv für sich beanspruchen, qua Wiederholung als eingängig. Und zweitens besteht die extraterrestrische Leistung des Komponisten gerade darin, Komplexität mit Verständlichkeit und Anspruch mit Zugänglichkeit zu kombinieren; der typische Beethoven-Sound ist oft einfach, schnörkellos und modern, freilich ohne ins Primitive abzugleiten. Beispielhaft, fast plakativ, lässt sich das an der Symphonie Nr. 5 (opus 67) festmachen. Das Schicksal klopft hier nicht einfach an – der Meister lässt es unverblümt und immer wieder die Tür eintreten. Wiederholung und Variation, Wesensmerkmale Beethovenscher Kompositionstechnik, werden ausgereizt; die Kunst besteht darin, mit diesem Spiel, das oft an die Grenze der Überbetonung geht, nicht zu langweilen. Auch darin ist der Mann aus Bonn State of the Art.
Revolution durch Evolution
Ein fast simples Motiv, eine geniale Idee, lässt er bis in die feinsten Verästelungen wachsen. Der signifikante Anfang ist es, der den Hörer sofort einnimmt, ergreift und nicht mehr loslässt. Ob kraftvoll (Klaviersonaten „Pathétique“ und „Appassionata“, opus 13 und 57), diabolisch (die letzte Klaviersonate und die letzte Symphonie, opus 111 und 125) oder verträumt („Mondschein“-Sonate und Klavierkonzert Nr. 4, opus 27,2 und 58): Wie so oft scheint das wegweisende Element des Kunstwerks – in diesem Fall der tonale Einstieg – nicht besonders ausgefallen.
Bei näherer Betrachtung aber entpuppt sich gerade das als die Meisterschaft. Aus der Tiefe geschürft, gereinigt und konzentriert, greifen die ersten Töne unmittelbar ins Rückenmark. Man kann das auf „Genie“ oder „Intuition“ zurückführen; nicht weniger treffend ist gewiss, diese Einleitungen als die Resultate jahrelanger intellektueller Arbeit zu betrachten.
Wie beim Schach – Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel – muss der Komponist entscheiden, welche Abfolge an Zügen er wählt. Dabei ist nicht nur die Struktur innerhalb eines Satzes, sondern auch die Gesamtstruktur eines Stückes zu berücksichtigen, also zu klären, in welchem Verhältnis die Sätze zueinander stehen. Beethoven, der den Hörer mit seinen ersten Sätzen nicht selten überrollt, demonstriert auch hier Bandbreite und Treffsicherheit. Er weiß genau, wann er auf einen legendären ersten Satz einen weiteren, überwältigend-schönen und damit emotional-fordernden Satz 2 folgen lassen kann (Klavierkonzert Nr. 5, opus 73), und wann der zweite Satz (erneut: Klaviersonate „Appassionata“) eine Ruhepause bilden muss, damit der Hörer den ersten überhaupt verkraften, geschweige denn den dritten und letzten ertragen kann. Keiner vermag diese Reisen zwischen tosenden Fluten, ruhigen Buchten, sanften Tälern und stürmischen Gipfeln souveräner und effektvoller zu gestalten als der Meister aus Bonn.
Bestie und Dompteur in einer Person
Dabei wälzt er das grundsätzlich Menschliche immer wieder hin und her, entwirft, analysiert, streicht, tobt, setzt wieder an, konstruiert, reißt ein – um am Ende doch zu triumphieren. Beethovens Schaffen ist schließlich auch Ausdruck des Kampfes mit sich selbst, den man hören, ja, fast greifen kann – eine Seelenschau, die dem sensiblen Hörer sämtliche Ecken und Kanten einer bipolaren Persönlichkeit offenlegt. Dazu bedarf es weder detaillierter Notenkenntnis noch musiktheoretischer Exzerpte. Faszinierend und schmerzhaft, wie die Schönheit des Violinkonzerts opus 61 (das einzige von Beethoven und das wohl gelungenste der Musikgeschichte) mit den abgründigen Dissonanzen der späten Streichquartette kontrastiert.
Besondere Lebensumstände, gepaart mit grenzenlosem Talent und unbändigem Willen, ermöglichten diese Revolution der Musikgeschichte. Seinen ungestümen Charakter, gereizt durch sich verstärkende Taubheit, ließ Beethoven ebenso ungeschminkt in seine Werke einfließen wie seine grenzenlosen analytischen Fähigkeiten.
Daraus resultiert eine extreme Bandbreite, die letztlich von der individuellen Radikalität der Werke lebt. Die Einzigartigkeit jeder Komposition ergibt sich einerseits aus den bereits angesprochenen Satzverhältnissen zueinander. Andererseits bilden bereits die Sätze selbst ungeheure dramaturgische Blöcke. Charakter und Atmosphäre der legendären „Hammerklavier“-Sonate opus 106 etwa ergeben sich in erster Linie aus dem nahezu unspielbaren Satz 1 und dem quälend langen Adagio von Satz 3. Es entsteht eine etwa 45 minütige Herausforderung für Pianist und Hörer, eine nervlich-physische Anstrengung, zum Teil an der Machbarkeits- und Belastbarkeitsgrenze. Dass man dennoch oft den Eindruck hat, die Sätze könnten so und nur so verlaufen und die Satzabfolge sei ebenso zwingend, dass also die extremen Innovationen natürlich und folgerichtig scheinen, ist ein weiteres Faszinosum des beethovenschen Universums. Anderssein ja – aber nicht um sich wichtig zumachen, sondern um des Resultats willen.
Herrscher vieler Reiche
Beethoven war Weltklasse-Pianist. Dementsprechend war das Klavier sein Leib- und Mageninstrument. Es nimmt daher nicht wunder, dass er gerade im Bereich dieser Sonaten als die unangefochtene Referenz gilt, ja, dass er diese Gattung gewissermaßen neu erfand. Dabei blieb es aber nicht.
Denn daneben setzte LvB auch im Bereich der Symphonie – die nichts anderes ist als eine Sonate fürs Orchester – neue Maßstäbe, genauso wie in seinen Instrumentalkonzerten, dem Zusammenspiel von Orchester und Solist. Außerdem stehen noch die „Missa solemnis“ oder die Oper „Fidelio“ sowie zehn Violinsonaten, die ebenfalls als bahnbrechend einzustufen sind.
Kurz: Beethoven hat es nicht nur vermocht, mehrere zeitlose Meisterwerke innerhalb ein- und derselben Gattung zu verfassen, ihm sind seine epochalen Würfe auch auf verschiedenen Gebieten gelungen. Gerade derjenige der drei großen Klassiker (außer ihm Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn, sein Lehrer), der am wenigsten komponiert hat, hinterließ mit großem Abstand die meisten Allzeit-Klassiker. Seiner lebenslangen Produktivität und der unglaublichen Qualitätsdichte zu Gute kam sehr wahrscheinlich auch, dass er verhältnismäßig spät mit seinen ersten Veröffentlichungen begann. Umfassend und auf höchstem Niveau ausgebildet, selbst aus einer Musiker-Familie stammend, gibt es nur wenige Ausreißer nach unten. Wie ausgeprägt sein Alkoholismus auch gewesen sein mag – Beethoven entwickelte bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts neue Ideen, also bis kurz vor seinem Tod.
Ringen um Perfektion bis zum Schluss
Wieder lässt sich dieses Phänomen wohl am besten anhand des Klavierwerks zeigen. Bereits das opus 7, die vierte Klaviersonate, ist äußerst eigenwillig und die zweitlängste Beethovens überhaupt. Ihren enormen Grad an Originalität, allerdings erheblich zugänglicher, erreicht spielerisch die weltberühmte Klaviersonate Nr. 21 „Waldstein“ (opus 53), die der mittleren Schaffensperiode zugerechnet wird. Während sich der Hörer die Klaviersonate Nummer 4 erarbeiten muss, kann er die „Waldstein“ bereits beim zweiten Zuhören praktisch mitsingen.
Man sollte meinen, dass alle, aber wirklich alle nur denkbaren Möglichkeiten des Instruments nach den 32 Sonaten ausgereizt wären. Das gilt erst Recht nach den letzten drei Sonaten (opus 109, 110, 111), die als musikalischer Geniestreich tatsächlich mit der Titulatur „die letzten drei Sonaten“ einerseits den simpelsten Eigennamen der Weltgeschichte begründet haben, andererseits von vielen als „letztes Wort“ der Gattung verstanden werden.
Dennoch vollendete der Meister erst danach, im Frühjahr 1823, sein solistisches Opus Maximum, die sogenannten Diabelli-Variationen (eigentlich: „33 Veränderungen über einen Walzer von A. Diabelli“, opus 120). Mit einer Spielzeit von fast einer Stunde und erneut erheblichen spieltechnischen Klippen demonstriert dieses Unikum, dass Beethovens Vitalität ungebrochen war.
Was aber erklärt – neben diesen Einordnungen im Einzelnen – prinzipiell seinen ungeheuren Erfolg?
Dadurch, dass fast sämtliche seiner Hauptwerke (ausgenommen die Neunte und die Missa solemnis) gesanglos, also ohne menschliche Sprache auskommen, sind die Werke jedem vermittelbar. Emotionalität und Geradlinigkeit versteht man selbstredend auf der ganzen Welt. Darüber hinaus sind sie aber auch alles andere als beliebig. Ohne Proklamation expressis verbis werden hier Standpunkte vertreten und kristallklare Bilder gezeichnet. Sie sind geprägt von scharfen Gegensätzen, die man aus dem eigenen Leben kennt und sofort begreift. Heiter zuversichtlich oder abgrundtief pessimistisch, sich in Hochgeschwindigkeit überschlagend oder tastend und sinnierend, zuweilen überraschend oder gar schockierend, in der Regel jedoch strukturiert und folgerichtig, gelegentlich ruppig, dann wieder anschmiegsam – das sind die Sphären, die Beethoven schafft und in denen er sich zeit seines Lebens bewegte. Eines der immer wieder innerhalb dieses Rahmens behandelten Themen war nicht zuletzt der uralte Kampf Gut gegen Böse.
Ergo: Beethoven gibt musikalische Antworten auf Fragen, die so alt sind wie die Menschheit. Effektvoll verknüpft er dabei das Ur-Bodenständige mit dem Elitären, offenbart uns die Herausforderungen dieser Welt und die Zerrissenheit des Menschen in grenzenloser Schönheit.
Tradition, Erbe, Verpflichtung
Wir, die weißen Frauen und Männer im Kernland Mitteleuropas, sprechen nicht nur seine Sprache, sondern empfinden eine instinktive, genuine Verbundenheit mit dem Klang seiner Kompositionen. Es ist unsere Pflicht, dieses Erbe zu bewahren, zu pflegen und zu verteidigen. Zum Einen aufgrund schlichter empirischer Tatsachen und aus einem subjektiven Blickwinkel: Es ist eben unsere Vergangenheit und nicht etwa diejenige Afrikas oder Asiens, und es ist unsere ureigene Prägung, auf die wir hier zurückblicken. Wie tief das in der Klassik gewachsene strukturelle Musikverständnis in unser aller Bewusstsein gedrungen und dort nach wie vor ungebrochen dominant ist, offenbart das Aktivhören des legitimen Nachfolgers der klassischen Musik, der harte oder progressive Rock, der die Geige und das Klavier durch E-Gitarre und Schlagzeug ersetzte sowie die Instrumental- mittels der Vokalmusik. Der Stolz, den wir als ethno-pluralistische Neurechte den anderen Nationen und Völkern allen linken Anwürfen zum Trotz respektvoll zubilligen, beanspruchen wir natürlicher Weise auch selbst. Wer aus Bonn kommt, wird mit Fug und Recht viel eher beim bloßen Namen „Beethoven“ eine Gänsehaut entwickeln als bei dem Gedanken daran, dass hier lange die sogenannte Hauptstadt Westdeutschlands verortet wurde.
Zum Anderen ist Beethoven im besten, im philosophischen Sinne tatsächlich international. Denn der objektive Blick auf seine Musik (also die interpersonelle, interkulturelle und interepochale Perspektive) zeigt: Er ist und bleibt die Krone der musikalischen Schöpfung. Wenn das Beste vom Besten unmittelbar vor der eigenen Haustür liegt, warum dann in Exotismus verfallen? „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ mag man das deutsche Sprichwort in Anlehnung an einen weiteren großen Deutschen, Johann Wolfgang von Goethe, zitieren. Neben Ästhetik, Heimatliebe und Lokalpatriotismus verbindet uns mit Beethoven allerdings noch eine weitere Tatsache: Auch er hielt nicht viel von damals gängigen Konventionen. Er schwamm ausdauernd gegen den Strom, bis er zu der großen Anerkennung fand, mit der ihn heute alle feiern.