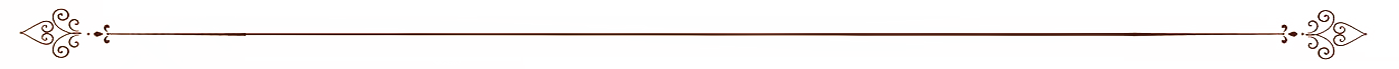Furries sind überall. Gerade Deutschland ist ein Hotspot für das Fandom, welches viel Hohn und Spott auf sich zieht. Doch diese Leichtfertigkeit lässt viele Analysen auf den Pfad einer erkenntnisarmen Kuriositätenshow abschweifen. In der Folge wissen heute wohl viele, was Furries sind – aber kaum einer weiß, was sie bedeuten. Dabei verfügt gerade die Rechte über jenen Werkzeugkasten an Erfahrungen, Begriffen und Mut zur Wahrheit, mit dem ein echtes Verständnis dieser Subkultur gezimmert werden könnte.
Das beginnt mit der Beseitigung eines konzeptuellen Fehlers. Setzt man sich zum ersten Mal mit Furries auseinander, so stolpert man wohl bald über die standardisierte Formel, die praktisch jeder als Definition anführt: Furries seien Fans anthropomorpher Tiere, interessierten sich also für Tiere mit menschlichen Eigenschaften. Sie seien in diesem Sinne nur eine neue Ausgeburt der menschlichen – allzumenschlichen! – Tendenz, sich auf alles und jeden zu projizieren. Ich erspare uns eine Liste historischer Beispiele.
Bei genauerem Hinsehen erweist sich diese Logik jedoch als grob irreführend. Ich möchte das an zwei Beispielen festmachen: Betrachtet man zunächst typische Furry-Medien, z.B. Zootopia (2016), so sind deren Charaktere nicht wirklich anthropomorphe Tiere. Judy Hopps ist weniger ein vermenschlichter Hase, als der Film-Archetyp des unterschätzen Neulings in Hasenform. Es wäre also passender, hier von einer theriomorphen Person zu sprechen. Und noch deutlicher wird dies bei unserem zweiten Beispiel: der Fursona.
Die Fursona dient explizit der Darstellung ihrer Urheber. Die sind, bleiben und verstehen sich dabei stets als Menschen, die sich lediglich eine tierisch angelegte Form geben. Dies unterscheidet Furries von Therians, die sich wirklich für Tiere in Menschenkörpern halten. Für Furries hingegen ist es gerade die alternative Darstellung ihrer zutiefst menschlichen Identität, welche den Reiz des Fandoms ausmacht. Und nirgends äußerst sich dieser Kerngedanke deutlicher als im zentralen Kultgegenstand des Fandoms: dem Fursuit.
Das identitäre Kostüm
Der Fursuit ist nun freilich ein Tierkostüm und erfüllt insofern alle die gleichen Zwecke, die auch ein Karnevalskostüm oder ein Cosplay-Outfit erfüllt. Durch die Veränderung der eigenen Gestalt entzieht sich der Träger kurzfristig seiner üblichen sozialen Rolle und wird ermächtigt, sich anders zu verhalten als sonst; nämlich in der Art, wie sie für den von ihm dargestellten Charakter passend wäre. Und genau hier liegt der Knackpunkt: Die meisten Kostüme, die wir tragen, stellen etwas Fremdes dar. Sie sind identitär irrelevant.
Der Fursuit als physische Manifestation der Fursona ist aber eine Repräsentation seines Trägers. Gerade durch die physische Verkleidung wird das wahre Selbst erst offenbart. Diese identitäre Funktion des Kostüms hat dabei archaische Vorläufer in den Riten des sogenannten Kóryos, also dem kriegerischen Männerbund indogermanischer Prägung. Diese Bünde praktizierten häufig eine Art theriomorphes Rollenspiel, in dem sie sich als Füchse, Wölfe oder Bären verkleideten und deren Verhalten nachahmten.
Ziel dieser Riten war es, die Krieger in diese Tiere zu verwandeln und ihnen somit deren Eigenschaften zu verleihen. Dieser magische Glaube spiegelt dabei eine psychologische Realität wider. Man erweckte eine bestialische Tendenz, die tief im Menschen und v.a. im Mann schlummert; und die in Zeiten des Kampfes enorm nützlich war. Gleichzeitig war diese Tendenz aber auch eine latente Gefahr. Was passiert, wenn diese Kraft sich gegen die Eigenen wandte, sieht man in Euripides‘ Darstellung von Herakles‘ Wahnsinn.
Wer also nicht enden wollte, wie dessen Familie, der musste den Menschen zivilisieren; ohne aber die Quelle seiner Lebenskraft völlig zu versiegeln. Und ein erfolgreiches Mittel hierzu war die Fesselung des Biestes an ein komplexes Mosaik ritueller Bedingungen, in dem das Kostüm ein zentraler Stein war. Auch wenn dies von den Menschen der Antike wohl nie derart gedacht wurde, fungierte es in diesem Sinne als eine Form kathartischer Selbstdarstellung für einen unterdrückten Teil der männlichen Identität.
Dionysische Dynamiken
Das Furry Fandom stimuliert einen ähnlich vitalistischen, identitären Ausbruch, und zwar v.a. im Kontext von Furry Conventions: Über einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen, umgeben von anderen Eingeweihten und unter großzügiger Beihilfe von Alkohol und Raves – Zaubersaft und Buschtrommeln –, tauchen die Teilnehmer in ihr tierisches Alter Ego ab. Die konzentrierte Erfahrung dieser Ekstase macht schnell süchtig und führt im Nachgang zu Entzugserscheinungen, die sogenannte Post-Convention-Depression.
Und sie setzt mitunter auch gewisse andere Energien frei. Dies ist der Punkt, an dem ich nicht umhinkomme, über die sexuelle Reputation des Furry Fandom zu sprechen. Furries bemühen sich ja, diesen Aspekt etwas herunterzuspielen. Es gäbe zwar diese Tendenz, aber es ginge nicht nur darum. Und das mag durchaus stimmen. Sicherlich gibt es große Teile des Fandoms, in denen dieses Thema völlig abwesend ist. Aber es ist signifikant genug, dass man es nicht einfach ignorieren kann.
Denn auch abseits realer Treffen haben viele Furries einen Hang zur Hypersexualität und wenig Skrupel diese Dinge jedem, der ihnen zuhört, zu erzählen. Allgemein teilen Furries ihr Seelenleben oft unaufgefordert mit Gott und der Welt. Diese Tendenz liegt zum Teil schlicht darin begründet, dass das Furry Fandom einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Bi- und Homosexuellen aufweist. Deren eigene Subkultur fördert einen – gelinde gesagt – sehr offenen Umgang mit Sexualität, Promiskuität und Fetischen.
Die Gretchenfrage lautet dann freilich, warum die Schwulenrate im Furry Fandom so hoch ist. Doch wer anfängt, über solche demographischen Besonderheiten zu sprechen, sollte erst einmal fragen: Warum sind die meisten Furries überhaupt Männer? Und was haben die noch gemeinsam? Betrachtet man die verfügbaren Statistiken, so zeigt sich: Sie sind fast ausschließlich weiß, oft technikaffin und hatten in der Schule meist gute Noten, aber wenige Freunde.
Auf der Suche nach Anerkennung
Solche jungen Männer unterliegen heute einem enormen Zivilisationsdruck. Bereits im Kindergarten und spätestens in der Schule wird ihre Lebenskraft zum Problem, ja sogar zur Krankheit erklärt. Ihre Interessen sind toxisch, ihre Begeisterungen kindisch; Witz und Verspieltheit sind genauso unerwünscht wie Kraft und Ehrgeiz. Und nach langen Jahren dieser betäubenden Konditionierung erwartet man dann, dass diese Männer beruflich, sozial und romantisch Erfolg haben. Denn Anerkennung gibt’s gratis nur für Opfer.
Solche Umstände provozieren mannigfache Formen von Eskapismus: Der Incel lässt die Gesellschaft als Ganzes hinter sich, der neurotische Soyboy ertränkt sich im Konsum, der Zocker versteckt sich in seinen Spielewelten, manche fliehen ins andere Geschlecht und Schwaerzel’s Schizoid Man hebt Eisen. In irgendeiner Kombination dieser Extreme findet sich das Gros der jungen Männer von heute. Und einige finden ihren Eskapismus eben im Furry Fandom mit seiner albern-bunten, disneyhaften Kuscheltieroptik.
Diese liegt wohl besonders den zarteren, schüchternen Geistern und greift dabei auf zwei mächtige Motive zurück: die Nostalgie einer unbeschwerten Kindheit; und das scheinbar so unbeschwerte Leben eines Haus- oder auch Wildtiers. Und das schließt wieder an die rebellische Tendenz des Kóryos an: Frei wie ein Vogel will man sein; also wird man zum Vogel. Und mal ganz praktisch betrachtet, bietet die (Fantasie-)Tierwelt eine solche Fülle an Designs, dass wirklich jeder Depp sich in dieser Ästhetik individuell ausdrücken kann.
Diese gefühlte Authentizität hat auch zur Folge, dass die soziale Anerkennung innerhalb des Fandoms emotional schwerer wiegt als die oft undankbaren Erfolge im bürgerlichen Leben. Da wird einem doch klar, warum so viele Furries ans andere Ufer driften: Statt dem Hedonismus einer rein sexuellen Befriedigung handelt es sich zuerst um die gegenseitige Erfüllung eines sozialen Bedürfnisses. Die rituelle Abgrenzung vom bürgerlichen Leben macht den Schritt in dieses ungesunde Verhältnis dabei äußerst einfach.
Die Politik der Unpolitischen
Und das, obwohl die Nischen-Ästhetik des Fandoms genug andere Möglichkeiten bietet, sich diese Anerkennung zu verdienen. Künstler sind da nur die Spitze des Eisbergs und sowieso zu 70% weiblich. Männliche Furries bereichern ihr Fandom eher um technische Lösungen, die durchaus staunen lassen: z.B. Robotik, die in Prothesen Anwendung findet oder Fursuit-Kühlsysteme, die vom Militär eingesetzt werden. Und eine Furry entwickelte ernsthaft ein Hirn-Computer-Interface, nur um die Ohren seines VR-Avatars zu bewegen.
Diese technischen, handwerklichen und künstlerischen Möglichkeiten begründen auch einen anderen, politischeren Aspekt des Fandoms: Fast alles, was Furries konsumieren wird auch von Furries hergestellt; meist als Selbständige oder in Kleinstbetrieben. Weder gibt es große Firmen und Verbände, noch werden die Vereine des Fandoms in irgendeiner Form staatlich alimentiert. Durch diese finanzielle Autonomie entzieht das Fandom sich nun freilich einem wesentlichen Vektor linker Hegemonie. Und das merkt man.
Einschlägige Vorwürfe, das Fandom sei ja zu weiß und zu männlich, verlaufen regelmäßig im Sande. Abgekanzelt wird man fast nur aufgrund echter Straftaten oder sehr fandom-spezifischer Ehrdelikte; z.B., weil man eine fremde Fursona unerlaubt abgekupfert hat. Obwohl der Großteil der Furries sich wohl eher links als rechts der Mitte verordnen würde, scheint es eine gewisse a-, wenn nicht sogar anti-politische Haltung zu geben. Gemeine gesellschaftliche Konflikte werden konsequent ausgeklammert.
Dabei ist diese Entpolitisierung ein zutiefst politischer Akt. Die gemeine Gesellschaft wird veräußerlicht, sie ist nicht nur Lacans „großer Anderer“, sondern Schmitts „potenzieller Feind“. Mit einer argwöhnischen Belagerungsmentalität blickt man auf ihre Macht, das Fandom durch den Entzug ihrer Toleranz zu schädigen; und man hütet sich davor in die stillen Bürgerkriege dieses Auslandes verwickelt zu werden. Und freilich bewirkt diese Neutralität auch eine relative Homogenisierung, die den inneren Zusammenhalt stärkt.
Wildtiere auf Waldgang
Nun stehen natürlich alle Subkulturen auch ein Stück weit außerhalb der Gesellschaft. Die Konsequenz, mit der diese Abgrenzung im Furry Fandom vollzogen wird, ist dann aber doch erstaunlich. Und für manche ist sie eine Quelle des Stolzes, ja sogar des Elitismus. Viele Furries verspüren eine gewisse Genugtuung darüber, dass ihr Fandom komisch und nonkonform genug ist, dass es selbst in der toleranten Regenbogengesellschaft lediglich erduldet, nicht gefeiert, wird. Und gerade ihre Ästhetik unterstreicht diesen Elitismus.
Einerseits, weil sie sich deren Albernheit völlig bewusst sind. Sie wissen, wie sie auf ihr Umfeld wirken, dessen Reaktion ist ihnen nur ziemlich egal. Das ist Selbstbewusstsein im doppelten Sinne. Es erinnert an die Einstellung eines Libertins, der keine Angst davor hat, sich lächerlich zu machen; denn er lacht ja gerne mit. Nun: Da Furries nicht intellektuell rechts oder besonders ideologisch geschult sind, verwechseln sie diesen Libertinismus oft mit einem linksliberalen „Anything goes!“. Faktisch ist jedoch das Gegenteil der Fall.
Denn, und das ist der zweite Aspekt ihres ästhetischen Elitismus, niemand zerlegt eine hässliche Fursona so gnadenlos wie eine Furry; nur das Gebot inneren Zusammenhalts hält sie da zurück. Jenseits dieser taktischen Erwägungen glauben viele Furries aber an eine objektive Schönheit, überlegende Geschmäcker und einen moralischen Imperativ wider die Hässlichkeit. So eine Sicht heute zu äußern, geschweige denn zu leben, muss man sich erstmal trauen. Aber das ist es ja: Furries leben sie nur temporär.
Nach der Convention, abseits von Twitter und VR-Chat, stehen sie wieder im normalen Leben. Sie arbeiten, shoppen und wählen wie brave Bürgerlein, eben während sie deren Spießigkeit verachten. Man mag das nun als Feigheit betrachten, doch mich erinnert es an Jüngers Waldgang. Im verschworenen Kreis der pelzigen Gefährten ruhen die Normen des falschen Lebens. Und damit lässt es sich vielleicht nicht richtig leben, aber es hilft anscheinend. Das stetige Wachstum des Fandoms leistet dafür Zeugnis ab.
Fazit
Eine anthropologische Studie des Furry Fandoms könnte Bände füllen. Dass dies noch nicht geschehen ist, liegt weniger an praktischen Problemen als am Unwillen, sich mit diesen Sonderlingen, ihrer absurden Ästhetik und ihren bizarren Praktiken zu assoziieren. Nicht nur wir Rechten hegen da eine biedere Reaktion. Doch wer sich mit diesem Thema ehrlich und ohne Scheuklappen auseinandersetzt, der kommt nicht umhin, gewisse Parallelen herzustellen. Denn irgendwo sind sie mit uns artverwandt; Anarchen auf der Flucht vor dem ewig erhobenen Zeigefinger. Und da scheint es mir angebracht, sie auch wie entfernte Verwandte zu behandeln: mit höflicher Indifferenz.