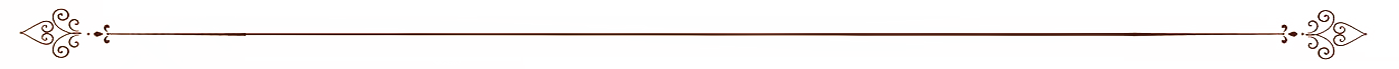In einem sehr langsamen Tempo beginnt dieser meisterhaft komponierte Film, mit Aufnahmen der majestätischen Wälder British Columbias, die uns in ihrer nebelverhangenen, herbstlichen Schönheit eine Ahnung davon geben, wie harmonisch und friedlich doch eigentlich alles sein könnte – wäre da nicht das Menschliche, allzu Menschliche.
Einsam und frierend durch diese Berglandschaft wandern sehen wir John Rambo alias Sylvester Stallone, einen ehemaligen Elitesoldaten und Vietnamkriegsveteranen, der auf der Suche nach dem letzten überlebenden Mitglied seiner Einheit ist, das hier irgendwo in den Bergen leben soll.
Ein stimmungsvoller Einstieg
Begleitet wird dieser wehmütige Einstieg von dem ikonischen Score von Jeremy Goldsmith, an dem sich bereits erkennen lässt, wie stimmig und perfekt aufgebaut der Film ist: Erst verleiht sanftes Gitarrenspiel der Natur eine romantische Stimmung, um dann aber von Bläsern ergänzt zu werden, die uns eine Vorahnung auf die kommende militärische Auseinandersetzung geben, uns warnend, der Idylle nicht zu trauen. Und dann setzen Streicher ein, eine Antizipation des bevorstehenden Schmerzes.
Rambos Kamerad ist, wie sich herausstellt, tot. Gestorben nach langem Siechtum an Krebs, den er sich in Vietnam zugezogen hatte. Der erschütterte Rambo, nun des Sinnes seiner Reise beraubt, weiß nicht, wohin mit sich, und macht sich auf den Weg in die nächstgelegene Ortschaft namens Hope, Washington.
Unterwegs trifft er auf den feisten Ortssheriff Will Teasle, dem man sofort anmerkt, dass er Rambo nicht ausstehen kann. Er hält dessen Feldjacke mit den Stars and Stripes für ein ironisches Statement gegen das Militär und Rambo für einen Landstreicher. Teasle macht ihm klar, dass er in Hope nicht erwünscht ist – doch Rambo ist nicht in der Verfassung, sich auch nur im Geringsten um Teasles Aussagen zu scheren. Diese anfangs kleinen Animositäten eskalieren, und der ehemalige Green Beret muss die Nacht in der Gefängniszelle verbringen. Als aber Teasles Deputys anfangen, ihn zu misshandeln, bekommt Rambo Vietnam-Flashbacks; panisch reißt er sich los und flieht in die Berge.
Jagt auf den Unliebsamen
Im Folgenden versuchen der unsympathische Teasle und seine sogar noch unsympathischeren Hilfssheriffs, für deren ganze Art und Aussehen sich das Prädikat „wohlstandsverweichlicht“ anbietet, den flüchtigen Rambo wieder in die Finger zu kriegen – ein Vorhaben, das zum Scheitern verurteilt ist, denn der durchtrainierte Einzelkämpfer, der in Guerillataktiken ausgebildet ist, hat absolut nicht vor, sich fangen zu lassen. Trickreich schafft er es, sämtliche Polizisten auszuschalten, ohne sie zu töten. Auch der später herbeigerufenen Nationalgarde bleibt Rambo immer einen Schritt voraus.
Der Fall schlägt Wellen und ruft die Lügenpresse auf den Plan, die Rambo als irren Mörder darstellt. Doch auch Rambos ehemaliger Ausbilder und kommandierender Offizier, Colonel Sam Trautman („Trautman“, „Teasle“ und „Hope“ sind übrigens sprechende Namen), betritt die Szenerie. Seinen Rat, die Treibjagd auf den Flüchtigen abzubrechen, schlägt der Sheriff in den Wind. Und so beschließt der in die Enge getriebene Rambo, zum Gegenangriff überzugehen. Mit aus einem Militärlaster gestohlenen Waffen gelingt es ihm, einen nicht geringen Teil der biederen Kleinstadt Hope, welche bis zur Lächerlichkeit mit Leuchtreklamen und Weihnachtsdekoration behangen ist, zu zerstören, in die Polizeiwache einzudringen und Teasle zu überwältigen.
Das Gebäude wird von der Polizei umstellt und Trautman als Unterhändler geschickt. Als Rambo mit seinem ehemaligen Befehlshaber spricht, erleidet er einen Nervenzusammenbruch, beginnt zu weinen und erzählt von seinen grausamen Kriegserlebnissen und jenem Trauma, das es für ihn darstellt, erstens den Krieg verloren zu haben, zweitens nach seiner Heimkehr von Demonstranten als Mörder beschimpft worden zu sein und drittens von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden, die ihm „nicht mal einen Job als Parkwächter“ geben wolle. Erst nachdem Rambo sich all dies von der Seele geweint hat, lässt er sich widerstandslos abführen und Teasle wird ins Krankenhaus gebracht.
Ist Rambo links?
Es gibt eine linke Lesart des Filmes, nach welcher der sympathisch porträtierte Rambo eine Art Che Guevara gegen das spießig-konservative Amerika ist. Eine aktuellere linke Interpretation sieht Rambo sogar als eine Analogie zu einem traumatisierten syrischen Flüchtling, der lediglich Aufnahme und Verständnis sucht, aber stattdessen nur von den lokalen Nazis gemobbt wird, welchen er dann, beinahe aus Notwehr, den Breitscheidplatz verpasst.
Und tatsächlich spricht einiges für eine linke Deutung des Filmes: Die gezeigten Polizisten und Nationalgardisten entsprechen vollkommen der typisch linken Sicht auf amerikanische Kleinstädter: Sie sind weiß, tumb, spießig, waffenstarrend, konservativ und tragen Eheringe. Ihnen steht Rambo als langhaariger Rebell gegenüber.
Schönheitsfehler dieser linken Interpretation: Ein Linker würde niemals den Green Berets beitreten, um anschließend für sein amerikanisches Vaterland durch die Hölle zu gehen, sich dabei die höchsten militärischen Auszeichnungen verdienend. Nein, sowas tun nur Patrioten. Das Sternenbanner auf Rambos Brust ist kein ironisches Statement, wie Teasle vermutet, sondern ernst gemeint.
Gegen Cuckservatives und Wohlstandsdegeneration
Der Film richtet sich nicht gegen Rechte im Allgemeinen, wohl aber gegen rechte Spießer. Teasle und seine Deputys mögen im linken Lager Abscheu hervorrufen, doch ebenso bei uns im dissidenten rechten Lager. Sie sind unförmig, borniert, weichlich und feige, sind ständig am Mampfen, konsumieren Kaugummi und Kautabak. Um ein modernes Wort auf sie anzuwenden: es sind „Cuckservatives“.
Feige Rechte, die zwar gerne alle Vorzüge genießen, die ihnen ihr Heimatland bietet, aber nicht bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, um ebenjenes zu verteidigen – ja, sogar gegen diejenigen vorgehen, die bereit sind, genau dies zu tun. Cuckservatives sind jener Schlag Konservative, die wir in Deutschland bei der CDU verorten würden, bei der jemand wie Martin Sellner ebensowenig „einen Job als Parkwächter“ bekommen würde, wie Rambo nach seiner Heimkehr in die amerikanischen Zivilgesellschaft, für welche er seine Haut zu Markte trug.
Der Film bietet ein klares Statement gegen Wohlstandsdegeneration: Wie viel besser fühlt sich der Zuseher in den gefährlichen, nebligen Wäldern – dem Habitat Rambos –, als in der Domäne Teasles: dem piefigen, mit Konsumtempeln, Zweckarchitektur und Reklame vollgestopften „Hope“, dessen Zerstörung uns keine Träne abringt. Ein Ort, dem sein Wohlstand nicht dazu verhalf, diesem ein erhabenes Antlitz zu verleihen, sondern nur, seine Bewohner zu fetten, feigen Spießern werden zu lassen.
„Rambo“ beinhaltet auch eine starke Kritik an den amerikanischen Kriegen – etwas, mit dem ausnahmsweise sowohl Linke als auch wir gut leben können. Und diese Kritik war vom Autor der Romanvorlage auch genau so intendiert: Einmal den Vietnamkrieg in die USA holen und die Amerikaner ihre eigene Medizin schmecken lassen. Jene Medizin, die 500.000 Vietnamesen das Leben kostete und ihr Land bis heute mit den krebserregenden Überbleibseln der damals versprühten chemischen Kampfmittel vergiftet.
Wie das Publikum den Film rettete
Interessant ist auch die Entstehungsgeschichte des Filmes. Sein perfekt anmutender Schnitt und harmonischer Aufbau sind Ergebnis einer langwierigen Trial-and-Error-Methode: Man führte ihn immer und immer wieder einem Testpublikum vor, infolgedessen der Rohschnitt von knapp vier Stunden auf 90 Minuten reduziert wurde. Auch wurden mehrere Endungen getestet, unter anderem eine, in dem Trautman das „Monster“ Rambo, das er selber geschaffen hatte, exekutiert.
Dass sich letztlich jenes menschliche Ende durchsetzte, das Rambo überleben lässt und überdies dem linken Mob, der den heimkehrenden Rambo als Mörder beschimpfte, einen saftigen Seitenhieb versetzt, ist allein dem Testpublikum zu verdanken. Diese Endung stieß natürlich auf den Hass der linken Rezensenten, die sie sogleich mit der „Dolchstoßlegende“ verglichen: „Wäre nicht der perfide Schluss (in dem ausgerechnet die Anti-Kriegs-Demonstranten für Rambos Zusammenbruch verantwortlich gemacht werden), könnte ‚First Blood‘ ein großer Film sein.“ (Die Zeit, 1983). Ein untrügliches Zeichen für die Qualität des Filmes.
Die Sequels sind, bis auf den schlechten fünften Teil, sehenswerte Actionspektakel, die aber aus patriotischer Sicht nur wenig interessant sind – mit Ausnahme des expliziten Verweises auf Rambos deutsche Abstammung, als im zweiten Teil aus seiner Dienstakte zitiert wird. In der Tat ist „Rambo“ ein althochdeutscher Nachname und bedeutet so viel wie „ruhmreicher Rabe“.