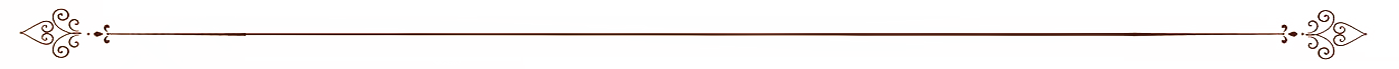Die Gaben der europäischen Zivilisation und die Hochkultur des weißen Mannes – so großzügig und wohlmeinend, an dessen Teilhabe einladend, in alle Herren Länder getragen und mit ihnen geteilt. Heute manifestieren sich diese Gaben pervertiert in der sich ihnen als unwürdig erwiesenen dritten Welt in der typischsten und sie prägendsten Form:
Versmogte Millionenstädte, durch deren schmutzige und stinkige Straßen sich Massen dunkler Menschen pressen – von den Slums bis in die Glasfestungen der Reichen durchzogen von Korruption, Gewalt und ethnischen Verteilungskämpfen.
In einer solchen Welt findet die Trilogie des alkohol- und opiatabhängigen Ex-Polizisten Max mit Max Payne 3 ihr verdientes Ende. Und das aus rechten Gründen.
Vom Noir zum Neo-Noir
Dabei begann die Geschichte des tragischen Helden nicht in jenem brasilianischen Höllenloch, des hier thematisierten Teils, sondern gemäß eines Film-Noir-Shooters in der kalten, dunklen Unterwelt von New York City.
Denn die Max Payne Reihe ist in ihrer Inszenierung in der Tat dem Film-Noir zuzuordnen und in gewisser Weise eine der ersten Videospielumsetzungen dieses Genres: Die dunkle und kontrastreiche Darstellung einer pessimistischen Kriminalgeschichte, begleitet von den kühlen, inneren Monologen des an der Welt zerbrechenden Protagonisten.
Die ersten beiden Teile der Trilogie wurden noch von dem finnischen Entwicklerstudio „Remedy Entertainment“ entwickelt und seinem Direktor Sam Lake geschrieben. Der dritte Teil wurde von „Rockstar Games“ entwickelt und die Geschichte von dessen Drehbuchschreiber Dan Houser vollendet.
Bei Max Payne handelt es sich grundsätzlich um einen Actionshooter mit einer Kriminalgeschichte rund um Intrigen, Verrat und Tod. Nach dem brutalen Mord an seiner Frau und Tochter begab sich der von Rache getriebene Ex-Polizist Max in einen Mahlstrom der Verschwörungen in die kriminelle Unterwelt New Yorks. Seitdem wird er geplagt von Schuld und Selbstvorwürfen, die ihn immer tiefer in das Loch seiner Depressionen und Drogenabhängigkeiten zogen.
Im dritten Teil nimmt Max den Auftrag als Personenschützer einer wohlhabenden und einflussreichen Familie in Brasilien an. Nach der Entführung der Trophäen-Braut des bonzigen Auftraggebers entsagt der von Schuld geplagte Max schließlich dem Alkohol, schlüpft in ein Hawaiihemd, rasiert sich eine Glatze und folgt in regelrechter Todessehnsucht einem öläugigen Menschenhändlerring tief in die brasilianischen Slums.
Stilistisch macht das Spiel eine kleine Kehrtwende von seinen Vorgängern und inszeniert seine Geschichte nun mit grell-gelben Farbfiltern, die die schwülende Hitze und sinnliche Überladung des exotischen Austragungsortes hervorragend einfangen. Zudem ist Max für den Großteil der Zeit alkoholisiert und unter Tabletteneinfluss – desorientiert und depressiv.
Was sich wie ein ganz gewöhnlicher Tag im Leben einer „Oma gegen Rechts“ anhört, ist hier allerdings bitterer Ernst und wird im Spiel mit dem gebührenden Respekt verarbeitet.
Berechtigte Kritik der Fans
Während der neue Austragungsort zunächst als Stilbruch zu den vorigen Teilen kritisiert wurde, so beschränkte sich die Kritik langjähriger Fans am dritten Teil nicht ausschließlich auf den Szeneriewechsel. Man muss ehrlicher Weise anführen, dass Rockstar etliche Aspekte der ersten Spiele (insbesondere des zweiten Teils) veränderte oder willentlich ignorierte, um Max als depressiven John McClane-Verschnitt in die nächste Abwärtsspirale hineinwerfen zu können.
Zumal viele Kenner der Reihe berechtigterweise anmerkten, dass die neuen Drehbuchschreiber einfach nicht den Charme des ursprünglichen Autoren Sam Lake getroffen haben, der den originalen Spielen ihr ambivalentes Verhältnis von Ernsthaftigkeit und surrealer Satire verlieh.
Doch da bereits die ersten Spiele auch von Actionvertretern des Hongkong-Films inspiriert waren (die unter anderem das westliche Actiongenre prägen sollten), ist die Traditionslinie mit dem dritten Ableger nicht vollkommen gebrochen worden: Max Payne 3 ist ein spielbarer Liebesbrief an moderne Actionklassiker wie „Stirb Langsam“, „Mann unter Feuer“ oder „96 Hours“.
Der alte, weiße Mann räumt auf – hier als wandelnder Todeswunsch mit Hawaiihemd und ’nem Kater aus der Hölle.
Doomer der ersten Stunde
„Diese Typen hatten für einen wütenden Gringo bezahlt, der es nicht vermochte Recht von Unrecht zu unterscheiden. (…) Mir wurde klar, dass sie Recht hatten: Ich hätte Recht nicht von Unrecht unterscheiden können, wenn einer von denen den Armen geholfen und der andere meine Schwester gevögelt hätte.“
Wer eine Schwäche für mittvierziger Männer hat, die in schlaflosen Nächten bei Zigarette und Whiskey wehmütig bis zynisch über den eigenen Verfall monologisieren, der ist bei Max Payne genau an der richtigen Adresse.
Der alte Haudegen spielt sein eigenes Leben zu Beginn der Geschichte nämlich auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Den Tod seiner Familie hat er sich nie verzeihen können. Trunken von der eigenen Melancholie geistert Max durch die liminalen Räume seiner eigens kreierten Hölle.
Max’ Melancholie ist indes ein zentraler Aspekt der gesamten Reihe. Dem aufmerksamen Betrachter wird dies allein schon am Namen des titelgebenden Protagonisten aufgefallen sein: Der Name „Payne“ in Anlehnung an das englische Wort „Pain“ bedeutet Schmerz. Maximaler Schmerz.
Die Geschichte, die für ihn als auch für uns in mehreren Rückblenden erst ihren wahren Sinn entfaltet, ist somit schon fast als eine allegorische Erzählung zu verstehen.
So bleibt das Konzept der Melancholie nicht unreflektiert oder nur bloßes Stilmittel. Denn die Moral der Geschichte ist: Selbstgerechtes Selbstmitleid führt zu destruktivem Defätismus.
Die Suche nach Erlösung
Erlösung meint Max nämlich zunächst nur in Form der Selbstaufopferung erfahren zu können. Dies schafft ein nahezu spirituelles Abhängigkeitsverhältnis zu jenen, denen er meint zu helfen aber die sich eigentlich nicht um ihn scheren oder (wie sich in der Handlung herausstellen wird) ihn gar abschaffen wollen. Davon kann unseresgleichen ein Liedchen singen:
Im Rahmen einer liberalen Geschichtserzählung ist unsere Kulturschöpfung darauf ausgelegt im Subtext stets mit der Selbstauflösung in Gestalt heroisch kontextualisierter Selbstaufopferung zu spielen. Die Selbstaufopferung zu Gunsten einer liberalisierten, multikulturellen und multiethnischen Gemeinschaft ist DER heroische Akt – die unausgesprochene „Redemtion-Arc“ unserer für schuldbeladen empfundenen Zivilisation.
Diese Form des Kulturgärtnerns zielt auf eine tiefgreifende Erziehung desjenigen ab, dessen Welt und Werteverständnis sie nachhaltig umzustrukturieren sucht: die Welt des weißen Mannes.
Das kann zur Mid-Wit-Falle werden. Denn diese Art der kulturellen und moralischen Unterwanderung entfaltet seine Wirkung häufig unterschwellig genau da, wo Geschichten aus einem pseudo-intellektuellen Elfenbeinturm heraus geschrieben oder rezipiert werden. Filme wie beispielsweise „Gran Torino“ haben dies unter Beweis gestellt.
Max Payne ist am Ende jedenfalls keine solche Geschichte.
Betondschungel der Perversionen
Max wird im Laufe der Geschichte erkennen, dass der Job als Personenschützer in Brasilien ein abgekartetes Spiel war. Er sollte bei der Entführung der Trophäen-Braut und innerhalb eines größeren, perfiden Plans schlicht der Sündenbock sein.
Seine Schuldstarre zog ihn in die Orientierungslosigkeit, von der ausschließlich jene profitierten, die nur in der Abwesenheit des „starken Mannes“ überhaupt erst existieren konnten: Kriminelle und parasitäre Fremde.
Doch Max kämpft sich durch die Abwärtsspirale seiner eigenen Leiden, die sich ihm im Betondschungel der Perversionen Sao Paolos metaphorisch offenbaren. Hinter der Fassade eines kunterbunten Karnevals der Kulturen verbergen sich innerhalb seiner Mauern brutalste Verteilungskämpfe und die düstersten Abgründe menschlicher Perversionen. Spätestens hier wird der düstere Film-Noir-Thriller zum knallharten Brasilero-Shooter.
Dabei geht es nicht um eine spezifische und mutwillig schlechte Darstellung des Landes Brasilien, sondern um eine zivilisationskritische Auseinandersetzung mit dem Geburtsfehler der modernen Amerikas: Als libertäre Feuchtträumereien gedacht und umgesetzt, sind diese losen, rein wirtschaftlich motivierten Gesellschaftsverbände in der Endkonsequenz kaum anders als mit Gewalt und staatlichen Umverteilungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten.
Oder anders gesagt: Bist du umgeben von einem immer größer werdenden Völkergemisch geprägt von sprachlichen, sozialen oder ethnischen Disparitäten, hat deine Heimat weniger etwas von einer Gesellschaft, sondern mehr etwas von einem Zoo.
Das Spiel vermag dies gemäß seines Genres auf eine Weise zu verarbeiten, die von sonstig intellektueller Hybris verschleiert oder verzerrt worden wäre.
Ein herausragendes Videospiel
Wenn sich jedenfalls kriminelle, asoziale Mulatten in gefälschter Sportmarkenausstattung an weißen Frauen vergreifen, und der Hauptprotagonist ein hartgesottener, weißer Ex-Polizist ist, dann weißt du, dass der multiethnische Umverteilungsstaat seine Lobbys in Form feminisierter HR-Departments zu dieser Zeit noch nicht in allen Ecken der Kulturlandschaft implementiert hatte.
Statt Tomboys, Tunten oder sonstigen Ausgeburten DEI trächtiger Entwicklerstudios, haben wir mit Max Payne 3 ein dezidiert männliches Kulturerzeugnis, das sich kompromisslos auch an eine solche Zielgruppe richtet. Und das in Form des wohl besten Third-Person-Shooters, den es jemals gegeben hat:
In eskalierenden Schießereien tötet Max seine Feinde und lädt damit seine „Bullet Time“ auf. Diese ermöglicht ihm, die Zeit zu verlangsamen und feindlichen Projektilen auszuweichen. Außerdem kann er in Zeitlupe durch die Gegend hechten und in der Luft weitere Kopfschüsse verteilen. Abgerundet wird dies durch die Verwendung der sogenannten „Euphoria-Engine“, in der Bewegungseffekte realitätsgetreu verarbeitet und abgebildet werden. Dies lässt die Schießereien in Max Payne so intensiv erscheinen, wie in manch gut gemachtem Actionstreifen.
Es gibt kein Level- oder Inventarsystem. Keine Zeit stehlenden Dialogoptionen, Quests, oder Schnitzeljagden nach Gegenständen. Das Spiel ist kein „Wage-Slave“-Simulator.
Entgegen der gewaltigen Open-World-Spiele, die Rockstar üblicherweise entwickelt hat, ist Max Payne 3 mit seinem linearen Aufbau eher kurzweiliger Eskapismus aber ein dennoch vielfach verkanntes Meisterwerk seines Genres.
Entzug vom Schuldstolz
Wenn Max sich am Ende im Flughafen Sao Paolos durch Wellen paramilitärischer Söldnertruppen kämpft, um den Epstein-ähnlichen Antagonisten von der Flucht auf seine „Lolita-Island“ abzubringen, hatte das für mich als Spieler etwas zutiefst befriedigendes.
Nicht nur weil das geschicklichkeitsbasiertes Gameplay im Zusammenspiel mit der kinematografischen Inszenierung hier seinen Höhepunkt erreicht, sondern weil Max dort letztlich seinen endgültigen und lang verdienten Frieden mit sich zu schließen vermag.
Sein Heroismus speist sich letztlich aus der Selbstbehauptung und der Überwindung der Schuld, nicht aus einer heroisch kontextualisierten Selbstaufopferung.
Somit kann die Geschichte uns, und soll vor allem unseren verirrten Landsleuten im Sinne dieses Artikels ein mahnendes Beispiel sein: Wollen wir unsere eigenen und die Geschicke unserer Zivilisation wirklich in schon fast religiösem Eifer auf dem Altar unserer eigenen Melancholie, unseres zerrütteten Verhältnisses zu uns selbst opfern, um uns spirituelle und moralische Erlösung von jenen zu erhoffen, die uns verachten oder denen wir egal sind? Oder wollen wir wie Max beginnen aufrecht und selbstbestimmt auf unseren eigenen Beinen zu stehen und unsere Schuldsucht als das zu erkennen, was sie ist: destruktiv und falsch.