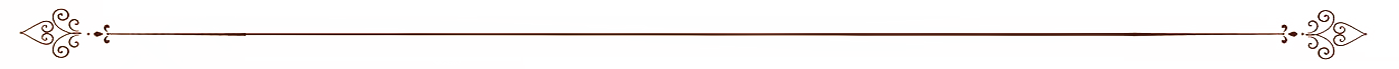Wenn man heute den Ruf „no pasáran!“ hört, sieht man sich in aller Regel mit einer Antifa-Horde konfrontiert, die eine Veranstaltung oder Demonstration politisch Andersdenkender mit Gewalt zu verhindern versucht. Der Ruf stammt aus dem Spanischen Bürgerkrieg und bedeutete, daß die „Faschisten“ nicht „durchbrechen“ würden. Bekanntlich irrten sie sich gewaltig. Der Spanische Bürgerkrieg spielt auch heute noch eine große Rolle für die Linken, die sich hier einen Mythos zurechtbastelten, der allerdings der Realität nicht standhält.
Im Bürgerkrieg gelten keine Regeln
Der Spanische Bürgerkrieg war ein extrem grausamer Krieg, in dem es keine humanitären Regeln gab. Dies ist vor allem den rotspanischen Fanatikern zu verdanken gewesen, bei denen ideologische und kriminelle Züge in gut bolschewistischer Tradition verschmolzen:
„In Aragon hatte eine kleine internationale Truppe von 22 Milizsoldaten aus allen möglichen Ländern nach einem leichten Gefecht einen fünfzehnjährigen Jungen gefangen genommen, der auf der Seite der Faschisten kämpfte. Er zitterte noch, weil er die Kameraden an seiner Seite hatte sterben sehen…Er wurde durchsucht; man fand bei ihm eine Muttergottes-Medaille und eine Mitgliedskarte der Falange. Er wurde zu Durutti geschickt, der ihm eine ganze Stunde lang die Vorzüge des anarchistischen Ideals schilderte und ihn dann vor die Wahl stellte, entweder zu sterben oder unverzüglich in die Reihen derer einzutreten, die ihn gefangengenommen hatten, und gegen seine früheren Kameraden zu kämpfen. Der Junge sagte nein und wurde erschossen. Durutti war in mancher Hinsicht ein bewundernswerter Mann…“ (Simone Weil zitiert in Hans Magnus Enzensberger, S.161)
Die Literatur der rotspanischen Seite
Die rotspanische Seite ist in der BRD im Gegensatz zur nationalspanischen Seite durch etliche lieferbaren, auflagenstarken Bücher präsent.
Der deutsche Autor Magnus Enzensberger, aus dessen „Der kurze Sommer der Anarchie“ das Eingangszitat stammt, hat ein seltsamerweise als „Roman“ deklariertes Buch verfaßt, das mittlerweile in der 22. Auflage bei Suhrkamp erschienen ist. Es ist eine kommentierte Zusammenstellung zahlreicher, überwiegend anarchistischer Zeitzeugenberichte rund um das Schicksal des dubiosen spanischen Anarchisten Durrutti, wobei kaum eine kritische Würdigung der rotspanischen Verbrechen erfolgt, und jegliches Unrechtsbewusstsein der Täter fehlt. Die durchgängige Linie der präsentierten rotspanischen Zeitzeugen besteht zu einem beträchtlichen Teil aus empathielosen, verrohten Gewalttätern oder Kriminellen, deren Taten anscheinend auch noch idealistisch erscheinen sollen.
Seltene Kritik und Gegenstimmen ändern nichts an dem offensichtlichen Unterfangen, Sympathien für den sich bestialisch austobenden Anarchismus zu wecken und Durrutti exemplarisch zu einem tragischen, idealistischen Helden zu machen. Die Tatsachen sprechen für sich.
Dum-Dum-Geschosse
„Mit einem naiven Lächeln, ganz frei von Sadismus, eher mit dem stillvergnügten Ausdruck von Kindern, die von einem gelungenen Streich erzählen, zeigen sie mir die Dum-Dum-Geschosse, die sie aus regulären Patronen gefertigt haben. Einer erklärte mir: „Für Gefangene!“ Damit will er sagen, daß eine solche Kugel auf jeden Gefangenen wartet.“ (S.149)
Bekanntlich sind diese international verbotenen Geschosse für das Verursachen von scheußlichen Wunden erfunden worden, die nicht nur extrem schmerzhaft, sondern in aller Regel tödlich waren. Dies ist nur ein Beispiel für die unmenschliche Kriegsführung der Roten, die vor allem gegen Zivilisten oft in pure Bestialität umschlug. Enzensberger sieht dies anscheinend mit einer distanzierten, aber wohlwollenden Gelassenheit.
Der unvermeidliche Brecht
Berthold Brecht war wie Enzensberger kein Spanienkämpfer. In seinem frei erfundenen Theaterstück „Die Gewehre der Frau Carrar“ (1937) hat er die Frage thematisiert, inwieweit man sich aus Konflikten heraushalten könne und dabei möglicherweise dem „Bösen“ durch Passivität zum Sieg verhelfe. Da Brecht in typischer Schwarz-weiß-Malerei das „Böse“ für die Nationalspanier und das „Gute“ für die Rotspanier festlegte, ist es ein reines Propagandawerk der kommunistischen Seite. Indem er in dem Stück auch das „Massaker von Málaga“ verarbeitete, das den Nationalspaniern und ihren Verbündeten angelastet wurde, zeigt er die Einseitigkeit seiner kommunistischen Parteinahme. Ein differenziertes Urteil durch eine Gegenüberstellung der Verbrechen beider Seiten konnte man von Brecht auch nicht erwarten, der nach dem Zweiten Weltkrieg bekanntlich freiwillig in die DDR übersiedelte, um dem kommunistischen Regime dort besser dienen zu können.
Hemmingway und Orwell
Die bekanntesten Zeitzeugen auf der Seite der Rotspanier sind Hemmingway und Orwell. Beiden Zeitzeugen dieses Krieges wurden berechtigterweise große Sympathien für die extreme Linke und eine selektive Wahrnehmung der Realität nachgesagt.
Hemmingway hat in seinem „Wem die Stunde schlägt“ eine Episode aus dem Guerillakrieg der Anarchisten im Hinterland von Francos Truppen beschrieben, die ursprünglich auf einer wahren Begebenheit beruhte. Neben der erwartbaren tragischen Liebesgeschichte werden hier die Anarchisten als idealistische „Antifaschisten“ unkritisch verherrlicht. Der eher dem Genre „Unterhaltung und Abenteuer“ zuzuordnende Roman wurde erfolgreich verfilmt und steht für die Verkitschung dieses Krieges durch Hollywood.
In Orwells „Mein Katalonien“ berichtet Orwell offen und ungeschminkt, wie er quasi zufällig in die stark anarchistische, revolutionär-marxistische POUM gerät und als Kriegsfreiwilliger auch an Kämpfen teilnimmt. Seine immer wieder durchscheinende Kritik an den Verhältnissen im Bereich der Rotspanier wird übertüncht von seiner Begeisterung für den notwendigen „antifaschistischen“ Kampf.
Orwell hatte schließlich seine Lektion gelernt
Orwell erscheint als naiver Beteiligter, der das ganze Ausmaß der sowjetkommunistischen Übernahme der rotspanischen Seite lange Zeit ausblendete. Später wurde er selbst von dessen Häschern bedroht und konnte sich in letzter Minute ins Ausland absetzen. Seine Gedanken zu Beginn des Bürgerkriegs zeugen jedenfalls von keiner demokratischen Grundhaltung:
„Außerdem ging es um die Frage des internationalen Prestiges des Faschismus. Dieses Problem hatte mich seit ein oder zwei Jahren verfolgt. Seit 1930 hatten die Faschisten nur Siege errungen, so war es an der Zeit, daß sie einmal geschlagen wurden, und es kam kaum darauf an, von wem. Trieben wir Franco und seine ausländischen Söldner ins Meer, würde das die Weltsituation gewaltig verbessern, selbst wenn Spanien unter einer Diktatur daraus hervorginge und seine besten Leute ins Gefängnis kämen. Allein schon eine Niederlage des Faschismus war es wert, den Krieg zu gewinnen.“ (Orwell, S. 226)
Immerhin hat sich Orwell auf Grund seiner damaligen Erlebnisse vor dem Hintergrund der kommunistischen Repression gegen linksextreme Konkurrenzorganisation von der radikalen Linken abgewandt. Mit seinen Büchern „Farm der Tiere“ und „1984“ machte er sein damaliges Engagement im Gegensatz zu dem gewaltaffinen, bekennenden späteren „Kriegsverbrecher“ Hemmingway jedoch wieder gut.
Ein linientreuer Kommunist: Steve Nelson
Als dritter Amerikaner soll hier der Kommunist Steve Nelson genannt werden, ein idealistischer „Arbeiterführer und Gewerkschafter“ aus den USA, der für seine aktive Teilnahme am Bürgerkrieg eine Zeitlang im US-Gefängnis saß. Nelson gehörte der anfangs noch in der Minderheit befindlichen kommunistischen Fraktion an. Stalin- und linientreu wie er war, kritisiert er in seinem Buch „Die Freiwilligen“ immer wieder die anarchistischen Mitkämpfer, die im Verlauf des Krieges dank harter kommunistischer Repressionen entweder, wie die POUM, komplett ausgeschaltet oder an den Rand gedrängt wurden. Nelson, der eine herausgehobene Stelle unter den ausländischen Freiwilligen einnahm, vertritt eine harte Linie, wie man es von den skrupellosen Kommunisten gewöhnt ist, die nur ihre „reine Lehre“ akzeptierten. Verbrechen der Rotspanier werden verschwiegen, bagatellisiert oder gerechtfertigt.
Zynisch und kaltherzig beschreibt er wie man nationalspanische Kriegsgefangene behandelte und noch stolz darauf war, gelegentlich „human“ zu töten:
„Er hob seine Mauser. Aber er war gnädig zu dem Leutnant; er schoß ihm nicht in den Bauch. Er schoß ihm durch den Kopf“. (S.159).
Angeblich überall Verräter und Klassenfeinde auf der eigenen Seite
Nelson bedient das Narrativ von den gefährlichen „Verrätern“ an Rotspanien im Gegensatz zu den moskautreuen Idealisten.
„Am dritten Morgen danach wurde die Luft in Albacete von einer Explosion erschüttert. Eine Fabrik, in der Handgranaten für die Armee hergestellt wurden, war in die Luft geflogen. Die Sache war ungeschickt gemacht worden. Innerhalb einer Stunde war der Verbrecher bekannt. Er wurde jedoch nicht sofort festgenommen, uns spät am Abend entdeckte man auf den Spuren dieses Mannes ein Nest der POUM – jener trotzkistischen Spionage- und Sabotageorganisation, die wenige Tage darauf den Aufstand von Barcelona anführen sollte.“ (Nelson, S. 96).
Auch andere, nichtkommunistische Mitkämpfer werden in ein schlechtes Licht gerückt, denn überall lauerten angeblich Saboteure, Klassenfeinde und Verräter, die es zu suchen und auszuschalten galt:
„Sie standen angetreten auf einem freien Feld; ein Offizier ritt die Front ab und besichtigte sie. Der Offizier saß auf einem gepflegten, lebhaften Pferd, und seine Uniform war elegant und gut gearbeitet… Die Vorstellung hatte einen falschen Klang. Da war dieser Offizier auf seinem Pferde, distanziert, ganz Militär wie nur irgendeiner. Und da waren diese Männer, die den Schlamm vom Jarama noch in den Ohren hatten, Männer, denen der Hintern aus der Hose schaute. Der Gegensatz war zu groß… Es gab nicht viele seiner Art in Spanien, aber es gab welche. Männer, die nicht aus irgendeiner starken politischen Überzeugung gekommen waren… Einige von Ihnen waren ehrliche Männer, die sich ganz einsetzten, und wieder einige von ihnen waren Verräter, und ihr Verrat kostete wertvolle Menschenleben, bevor er entdeckt und bewiesen war.“ (Nelson S.111 f.).
Moskau setzte sich brutal durch
Auf rotspanischer Seite standen anfangs auch Bürgerliche, gemäßigte Linke und Gruppen, die Moskau kritisch sahen. Aus kommunistischer Sicht konnte man sie nur vorrübergehend dulden:
„Hm – aber trotz allem gibt es einen Haufen Dinge in diesem Krieg, die mir selbst nicht gefallen. Es sind eine ganze Menge Kapitalisten zuviel in der spanischen Regierung… „Leute von der fünften Kolonne“, sagte Ruby. „Man sollte sie rausschmeißen und erschießen“… Ich sagte: „Du meinst, wir könnten den Krieg gewinnen und die Revolution verlieren?“… Sie alle kannten das Schlagwort der spanischen Trotzkisten und wußten ebenfalls aus eigener Erfahrung, daß von den Trotzkisten nur Lügen und Verrat kommen konnten“. (S. 130).
Die moskautreuen Kommunisten rissen schließlich mit brutalster Gewalt alle Macht an sich und dominierten die rotspanische Seite. Dabei kam es besonders mit den Anarchisten und anderen Linken zu regelrechten Straßenkämpfen im Rücken der Front. Moskaus Alleinherrschaftsanspruch hat Rotspanien viele Sympathien gekostet und es maßgeblich geschwächt. Nelsons Buch erschien 1955 in der DDR.
Viele Zeitzeugen sind gefallen oder wurden ermordet
Viele qualifizierte Zeitzeugen, die Berichte hätten schreiben können, sind im Bürgerkrieg auf beiden Seiten gefallen. Auf rotspanischer Seite gab es später auch Weltkriegstote. Erwähnung verdienen besonders die vielen auf Befehl Stalins liquidierten eigenen „Genossen“. Wer Glück hatte, war in und außerhalb von Lagern zum Schweigen verurteilt.
Belletristik und Geschichtsschreibung
Wenn man die hier vorgestellten Zeitzeugenberichte in belletristischer Form in ihrer Gesamtheit betrachtet, ergibt sich nur dann ein einigermaßen objektives Bild, wenn man die Bücher von Historikern hinzuzieht. Bei beiden handelt es sich aber in aller Regel um Darstellungen, die vom jeweiligen subjektiven, politischen Standort abhängen. Daher sind sie mit der gebotenen Vorsicht zu genießen. Immerhin muß man der Belletristik der Zeitzeugen zugutehalten, dass es Berichte sind, die auf einem hohen persönlichen Einsatz und Risiko beruhten und man auf beiden Seiten voller anfänglichem Idealismus war.
Von Fanatismus bis Ernüchterung
Die besonderen Grausamkeiten des Krieges wurden unterschiedlich erlebt und beurteilt. Neben fanatischem Hass findet sich Ernüchterung und Abscheu. Manch einer der Idealisten ist nach dem Krieg ein anderer Mensch geworden. Bemerkenswert ist hierbei eine gewisse anfängliche Naivität beim Entschluß zu einer persönlichen Beteiligung am Krieg, erschreckend eine Verniedlichung oder Akzeptanz von Gräueltaten gegenüber dem Gegner. Die rotspanische Seite hat hier mit Sicherheit die größte Verantwortung für diese Exzesse, die auf beiden Seiten begangen wurden.
Fazit:
Belletristische Bücher helfen zum tieferen Verständnis dieses Konfliktes, in dem Zigtausende Freiwillige aus zahlreichen Ländern auf beiden Seiten beteiligt waren. Es liegen Bücher unterschiedlichster Art vor, die die Vielfalt an politischen Einstellungen widerspiegeln. Die meisten Beteiligten beider Seiten wurden durch die politischen Entwicklungen sowie den Verlauf des Konflikts enttäuscht. Dies galt besonders auch für viele Rotspanier, die nicht für eine Bolschewisierung Spaniens unter Moskaus Kontrolle kämpften. Letztlich konnte Spanien dieses Schicksal durch einen grausamen Bürgerkrieg erspart bleiben und Europa von dieser Gefahr befreit werden.
Literaturauswahl zu Teil I und II:
- Antelope Hill Publishing (Hg.): José Antonio Primo de Rivera – Anthology of Speeches and Quotes (Sachbuch)
- Frederick R. Benson: Writers in Arms (Sachbuch)
- Berthold Brecht: Die Gewehre der Frau Carrar (Bühnenstück)
- Eoin O`Duffy: Crusade in Spain
- Hans Magnus Enzensberger: Der kurze Sommer der Anarchie
- Helmut H. Führing: Wir funken für Franko
- Nick W. Sinan Greger: Jose Antonio Primo de Rivera (Sachbuch)
- Ernest Hemmingway: Wem die Stunde schlägt
- Peter Kemp: Mine Were of Trouble
- Ramiro Ledesma Ramos: Speech to the Youth of Spain (Sachbuch)
- Legion Condor: Deutsche kämpfen in Spanien
- Arthur F. Loveday: Spain 1923-1948 (Sachbuch)
- Henri Massis/Robert Brasillach: Die Kadetten des Alcázar
- Steve Nelson: Die Freiwilligen
- George Orwell: Mein Katalonien
- Wilfried von Oven: Der Spanische Bürgerkrieg (Sachbuch)
- Georg Pichler: Der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939) im deutschsprachigen Roman: Eine Darstellung (Sachbuch)
- Pierre Drieu la Rochelle: Der falsche Belgier