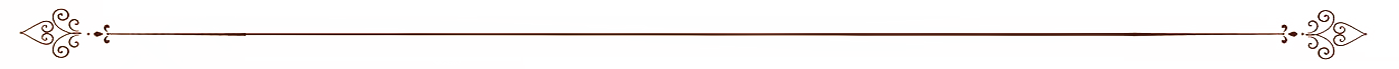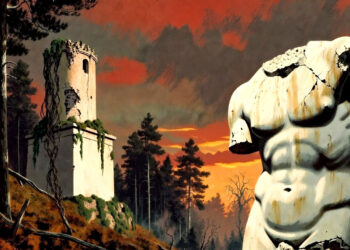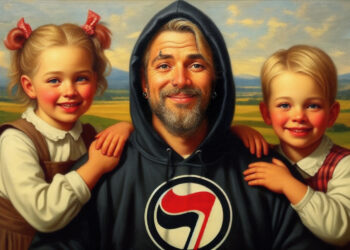Sollte man seine Feinde böse nennen? Gibt es das Böse überhaupt? Warum identifizieren sich manche in der politischen Welt mit dem Bösen und wieso sehen sich andere als die Guten? Sind Linke bösartig oder geisteskrank? Die Frage des Bösen ist bekanntlich komplex und oft eine Frage der Perspektive, der Absicht und der Konsequenzen. Sie ist nicht nur bei Fragen der Ethik, sondern gerade heutzutage auch bei Fragen der Politik von größter Wichtigkeit. Deswegen ist es Zeit für eine kleine politisch-philosophische Anleitung zum Bösen.
In unseren Köpfen stellen wir uns das Böse meist in Form eines Monsters vor. Es gibt viele Arten von Monstern, die mich erschrecken: Monster, die gerne Ärger verursachen, ohne sich zu zeigen, Monster, die alles in Schutt und Asche legen wollen, Monster, die Kinder entführen, Monster, die Menschen ihrer Träume berauben, Monster, die Blut saugen und Monster, die nichts als Lügen erzählen. Lügenmonster sind besonders schlimm: Sie sind viel schlauer als andere und treten als Mensch auf, obwohl sie nicht wie einer empfinden.
Auch wenn das Böse auf uns abschreckend wirkt, fühlen sich viele davon angezogen.
Über Extreme, die sich mit dem Bösen schmücken
Gerade bei jungen Menschen, die sich an den Rändern des politischen Spektrums bewegen, gibt es das faszinierende Phänomen der Vorliebe für das Böse – zumindest optisch.
Dies geht weit über Trupps mit Totenkopfmasken und Baseballschlägern und schwarz angezogenen Randalierern hinaus. Heutzutage suchen sich die Leute mit immer schnellerem Tempo neue Symbolfiguren mit dem gleichen Muster: Rechte verehren tragische Bösewichte wie Patrick Bateman aus American Psycho oder den nihilistischen Joker aus The Dark Knight – Charaktere, die eigentlich als Warnung gedacht waren. Linke wiederum identifizieren sich mit Harley Quinn, der durchgeknallten Freundin des Jokers, oder feiern Revolutionäre, die eine blutige Spur in der Geschichte hinterlassen haben.
Aber warum diese Selbstinszenierung als Bösewichte? Der Reiz vom Bösen in Form von Einschüchterung und Härte hat mutmaßlich mehrere Ursachen: Zum einen lehnt man als Außenseiter die Ästhetik des Hauptstroms automatisch ab. Dazu kommt, dass die Aura der Stärke und Gleichgültigkeit es ihnen erlaubt, eine Machtfantasie auszuleben, aber auch wirklich angsteinflößender zu sein. Wer sich machtlos fühlt, den spricht das an. Besonders im Netz gewinnt man Aufmerksamkeit durch Provokation, was den Leuten einen Weg bietet, sich von den „Langweilern“ abzugrenzen.
Die Identifizierung mit dieser Optik bringt die große Gefahr mit sich, dass jemand wirklich den Bösewicht in der Geschichte seiner Feinde spielt. Nietzsche sagte nicht ohne Grund, dass der Abgrund auch zurück in einen hineinblickt. Es ist einerseits Konsens, dass Macht korrumpiert, aber die Machtlosigkeit kann andererseits ebenso den gleichen Effekt haben.
Das Gegenbild des „New Guy“
In den Köpfen radikaler Anhänger mag der Kampf zwar gerechtfertigt sein, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Den Verlust des Bezugs zur realen Welt und zu grundlegenden menschlichen Werten sieht man im Netz zuhauf. Hier kommt das „New-Guy“-Mem ins Spiel.
Das „New Guy“-Mem stammt aus einem Mini-Comic einer Netz-Künstlerin. In dem Comic macht eine lila haarige Figur, die eine Personifizierung der Künstlerin selbst ist, sich über einen „Millionär-Gamer-Bro“ lustig, der ausgeraubt wurde, was klar eine Anspielung auf den Einbruch beim Youtuber „PewDiePie“ im Dezember 2019 ist. Der „New Guy“, ein neuer Kollege mit Namensschild, reagiert darauf mit Mitgefühl und fragt: „Hey, wie würde es dir gefallen, wenn du ausgeraubt würdest?“ Die Personifizierung der Künstlerin setzt dann noch einen oben drauf und feindet sich mit dem „New Guy“ an. Es ist zwar unglaublich, aber die Künstlerin sah sich in der Position des Guten.
Nicht nur der Textinhalt lässt die Künstlerin unsympathisch dastehen, sondern auch die visuelle Darstellung: Während ihr Antagonist das Ebenbild des sanften Riesens ist, also eine freundliche Figur mit rundem Kopf und sanftem Lächeln, stellt sich die Autorin selbst als spöttisch dreinschauend und eckig gezeichnet dar.
Da die kognitive Dissonanz der Künstlerin so riesig war, ging der Comic viral und erzeugte etliche Parodien und Reaktionen. Der „New Guy“ wurde dabei vom Netz zum Helden gekürt, der mit seiner wohlwollenden Menschlichkeit von allen geliebt wird.
Die lila haarige Figur ist somit unabsichtlich ein Symbol für Personen, die ihre Ideologie so stark verinnerlicht haben, dass sie ihre Empathie verlieren und negative Ereignisse bejubeln, solange sie ihren Überzeugungen entsprechen. Der „New Guy“ dient dabei als Kontrastfigur, die Menschlichkeit und Mitgefühl unabhängig von ideologischen Standpunkten repräsentiert.
Die Reaktion auf den Comic war stark genug, um linke Ideologie bloßzustellen und hat die Künstlerin nach dem Viralgehen seit fünf Jahren vom Netz ferngehalten. Das Mem zeigt uns also eine Möglichkeit, wie man Linke entlarvt: Es reicht der unschuldige Einwand. Wenn Ideologen sich nach außen hin aggressiv, zerstörerisch und einschüchternd präsentieren, sollten sie sich nicht wundern, wenn Außenstehende sie nicht als die Guten erkennen.
Böses benennen offenbart die Wahrheit
Philosophisch gibt es verschiedene Ansichten: Für Metaphysiker ist das Böse die Abwesenheit des Guten, für Deontologen wie Immanuel Kant ist das Böse die bewusste Abkehr vom moralischen Gesetz, für Utilitaristen ist das Böse mit der Maximierung von Leid und Minimierung von Glück verbunden.
Oft hört man, dass es so etwas wie das Böse gar nicht gäbe und dass es nur „Fehlgeleitete“ gibt. Das Böse ist demnach eine menschliche Konstruktion. Im postmodernen Kontext wird dann dazu erwähnt, dass es nur Macht statt Gut und Böse gibt. Andere (meist Religiöse) glauben, dass das Böse eine objektive Realität ist.
Um in der Gesellschaft das Falsche zu offenbaren, ist die Vorstellung von großer Hilfe. Gerade deswegen zieht man politisch den Kürzeren, wenn man Böses nicht benennt. Im Westen sieht man dies viel bei Bürgerlich-Liberalen: Sie räumen Linken großzügig ein, das Gute zu wollen, aber grenzen Rechte systematisch aus und machen sie moralisch verächtlich. Linke nutzen dies aus und deswegen gewinnen sie, obwohl sie eine falsche und böse Moral haben.
Es geht mir also nicht darum, über das Konzept und dessen Geltungsbereich zu streiten, sondern dass Unvereinbares, dessen Falschheit ergründet ist, für die Offenlegung auch als Böse benannt werden muss.
„Aber sie meinen es ja nur gut“
Böse Handlungen können aus niederen Trieben (Neid, Hass, Gier) entstehen, aber auch aus Überzeugung, Ignoranz oder Pflichtgefühl. Man kann auch böse sein, wenn man es wirklich oder vermeintlich gut meint. Die Idee „Der Zweck heiligt die Mittel“ wurde in der Geschichte schon oft als Rechtfertigung für grausamen Umgang verwendet. Verbunden mit Fanatismus (z.B. islamischer Extremismus) kann dies unermesslichen Schaden anrichten.
Dies geht aber noch viel weiter: Mitgefühl kann Menschen böse werden lassen. Vor allem bei links-bürgerlichen Gutmenschen kennt man dies. Sie identifizieren sich gerne mit dem Guten und werden dadurch unbewusst böse. Das Konzept von Luxusansichten (Rob Henderson) spielt hier eine Rolle.
Luxusansichten schaden den Ärmeren und geben verkommenen Eliten die Chance, sich als Opfer oder Retter darzustellen und Schaden ohne Konsequenzen anzurichten: Polizei der Finanzierung entziehen, Drogen entkriminalisieren, Schulbewertung abschaffen, Ehe abschaffen, Ritterlichkeit abschaffen (dies schadet vor allem ärmeren Frauen), Masseneinwanderung in arme Viertel befürworten, normale Familie abschaffen sind nur ein paar der Beispiele. Der Krux an der Sache, ist das all diese Probleme die verkommenen Eliten meist gar nicht betreffen: Es geht um das Aufgeben des Eigentums und der Sicherheit anderer für Gratismut.
Bei vielen sogenannten Gutmenschen kann man klar sagen, dass sie es nicht gut meinen. Für manche ist die Selbstdarstellung reiner Egoismus: Das Streben nach Gratismut ist stark mit Narzissmus und Machiavellismus verbunden. Für andere sind ihre Ansichten lediglich Masken für ihren Neid und Hass auf Erfolgreiche oder ihren Hass auf z.B. Deutsche und Christen. Sie sprechen nicht wirklich von Nächstenliebe, wenn hassbesessene antideutsche Politiker Rechte als unchristlich kritisieren für ihre Position gegen Masseneinwanderung. Die gleichen Leute wollen ja auch jegliche Religion für immer abschaffen.
Wenn man sich die Aktivitäten dieser Politiker im Netz anschaut, erscheint einem ein anderes Bild naheliegender: Es ist keine Nächstenliebe, die sie antreibt, sondern ein Nächstenhass und bestenfalls eine Fremdenliebe. Die Fremdenliebe, gerade in Bezug auf die Liebe zu den gefährlichsten Gruppen, ist aber auch böse: Das systematische Vergeben und Freisprechen von Triebtätern ist sogar eine ganz besondere Form des Bösen: suizidales Mitgefühl.
Bosheit zeichnet sich für gewöhnlich durch einen Mangel an Mitgefühl aus. Man sieht aber, dass Bosheit ebenso ein Teil davon sein kann. Mitleid ist dabei etwas Anderes als Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet Liebe und Fürsorge sowie Verständnis und Anteilnahme zu zeigen. Friedrich Nietzsche kritisiert bekanntlich Mitleid. Es stellt Leid als Tugend dar und vergrößert es damit nur und hemmt die Starken. Gerade aus spieltheoretischer Sicht wird schnell klar, dass Leid als Tugend gesellschaftlich schnell nach hinten losgehen kann: Wenn die Menschen für Umverteilung und Anerkennung sich schwach darstellen oder schwach werden, läuft was falsch (z.B., wenn Menschen auf Leute mit Identitätsstörungen neidisch werden). Wenn die Menschen keinen Anreiz mehr fühlen, stärker zu werden und Verantwortung zu übernehmen, dann ist Schwäche für sie besser als Stärke und eine Gesellschaft degeneriert.
Die unabsichtliche Form des Bösen, die das 20. Jahrhundert auszeichnet, ist das systemische Böse. Hannah Arendt sprach von der „Banalität des Bösen“: Menschen können Böses tun, ohne sich selbst als böse zu sehen. Das System hat sie nämlich zu diesen Taten gedrängt.
Das böse System und seine Ursprünge
Arendt sah als das größte Böse ein System, das die Leute durch Gehorsam zu bösem Handeln bringt und eine Bosheit erzeugt, die durch niemanden begangen wurde. In diesem verbürokratisierten System ist jeder, der kein Kind mehr ist, also Eigenverantwortung übernehmen kann, mitschuldig durch seinen blinden Gehorsam.
Den Ursprung vom Stalinismus, Kommunismus, NS, oder Totalitarismus sah Arendt in der verlassenen Massengesellschaft (also im Mangel an Verankerung in Zunft, Handwerk, Großfamilie oder Gemeinschaft). Der Staat übernimmt dann die Rolle dieses Bezugspunktes. Damit das totalitäre System überlebt, verfolgt es die, die es kritisieren. In dem Ziel der klassenlosen, reinen oder klimagerechten Welt werden sich immer neue Feinde gesucht. Der totalitäre Staat sucht sich stets ein bösartiges Feindbild einer niederen Made (der dumme Wutbürger), die paradoxerweise gleichzeitig das System gefährdet („Demokratiegefährder“).
Zu so einem System gehört aber noch etwas: Totalitäre sorgen für einen unantastbaren Konsens durch Weglassen von Informationen und durch Massenempörung, wenn jemand etwas hinterfragt und durch das Verorten von Gut und Böse mit bestimmter Semantik (Angriffskrieg, Terror, Freiheitskämpfer).
Diese Art der psychologischen Beeinflussung muss uns also stets bewusst sein: Wir sind alle beeinflussbar und man kann mit Autorität viele Menschen leicht zu bösem Verhalten bringen.
Sind Linke geisteskrank, bösartig oder bösartig und geisteskrank?
Manchmal sehe ich Diskussionen darüber, welcher Anteil der Linken oder „Woken“ bösartig ist und welcher geisteskrank ist. Häufig vertreten erscheint dann die Ansicht, dass die Mehrheit der Linken eher geisteskrank wäre und eine Minderheit böse wäre. Was damit für mich gemeint ist, ist die bereits besprochene Frage der guten Absicht. Wie viele von ihnen hassen das Nächste und wie viele lieben das Fremde? Wie viele lieben die Umwelt mehr als den Menschen und wie viele sind von der Menschheit angewidert und wollen sie systematisch reduzieren? Die Prämisse der Debatte ist dabei, dass sich Bösartigkeit und Geisteskrankheit gegenseitig ausschließt.
Die, die davon ausgehen, dass Linke geisteskrank und bösartig sind, sagen in der Essenz, dass ihre Ideologie sie ungesund macht und sie diese Ungesundheit böserweise auf andere forcieren.
Was das Argument für Geisteskrankheit angeht, ist die Assoziation von liberaler Zuordnung mit geistigen Problemen gut begründet. Bild- und Nius-Leser sind sich in Kommentarsektionen beim neusten Vorstoß der Linken hier auch meistens einig. „Die sind doch irre!“ oder „Gendergaga!“ sagen sie viel und gerne. Das ist aber letztlich ein Ausdruck des bereits genannten Mangels an Moralisierung von Bürgerlich-Liberalen (oder des Glaubens, dass „die ja im Grunde recht hätten“). Gerade diese Leute müssen dringend lernen, was Mitarbeiter bei der ZDF-Redaktion, beim Monitor oder linksradikalen NGOs mit ihnen machen würden, wenn sie genügend Macht hätten. Sie müssen verstehen, wie verbittert diese Leute über ihr Feindbild des Ostdeutschen oder alten weißen Mannes denken und dass Leid an ihrem Feindbild diese Leute nicht kümmert oder sogar erfreut.
Natürlich erscheint uns vieles bei ihrem Verhalten als rein geisteskrank (gerade in Bezug auf Selbstverletzung). Auch ich gebe zu, dass ich gelegentlich nichts Anderes darin erkennen mag. Aber ihre Logik ist (meistens) kongruent. Die Taten eines Irren wären uns ein Rätsel, aber die der Linken haben leider ein System, dass sie bei jedem neuen Vorstoß und jeder neuen Begrifflichkeit halbwegs erklären. Auch wenn sie eher Mitläufer sind oder nicht mal wissen, dass sie die Positionen von Linksradikalen nachgackern (das gibt es mehr als man denkt) oder es sogar gut meinen, sind sie letztlich mitschuldig an diesem System und somit auch eher als böse zu betrachten.
Wie wir durch Hannah Arendt wissen, kann dieses Böse durch die Mitschuld am System auch sehr klein sein. Man muss die Leute also gar nicht in böswillig oder geisteskrank einteilen oder sie alle dämonisieren, viele sind ganz einfach massivst manipuliert. Es liegt an uns, diese Menschen zu retten.
Empfehlung einer klaren moralischen Sprache
Damit Ungerechtigkeiten und Missstände klar benannt werden können, brauchen wir eine präzise moralische Sprache. Ein Verhalten oder ein System muss eindrücklich als moralisch falsch identifiziert werden, um die nötige Klarheit zu schaffen und andere davon zu überzeugen. Deswegen folgen zum Abschluss ein paar Begriffe mit Beispielen dazu, bei denen Sie sich überlegen können, ob Sie sie in Ihren Wortschatz mit aufnehmen.
- Das absichtliche Handeln von Aktivisten mit einem Feindbild, von dem sie hassbesessen sind, ist böswillig, rachsüchtig und beweist einen Groll.
- Das empathielose Verhalten von mächtigen politischen Akteuren, seien dies Beamte, die lachend ihre Befehle ausführen oder die Anzeigehauptmeister in der Regierung, ist grausam, rücksichtslos, zynisch, herzlos, unmenschlich und sadistisch.
- Das manipulative und täuschende Verhalten, wie man es z.B. in Europa von vermeintlich „konservativen“ Parteien, von angeblich „neutralen“ NGOs, oder von eigennützigen, mit Linken zusammenarbeitenden Fremden, kennt, ist hinterlistig, tückisch, verräterisch, verlogen, heuchlerisch und hinterhältig.
- Die vielen Menschen, die eine hohe Position z.B. durch den Staat haben und diese Macht missbrauchen, sind übergriffig, tyrannisch und erpresserisch.
- Die verantwortungslosen Mitläufer, die die Lage für sich ausnutzen, denen andere egal sind oder bewusst ihren Mund halten, sind feige, rücksichtslos, egozentrisch und bequemlich.
- Der Staat, der auserwählte Gruppen ihrer Freiheit beraubt, sie zu seinem Vorteil ausnutzt und sie systematisch benachteiligt und verfolgt, ist strukturell und systemisch böse: Er ist ungerecht, diskriminierend, unterdrückend, ausbeuterisch und korrupt.