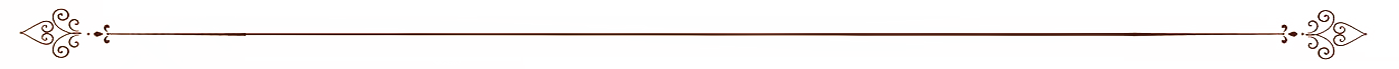Es war eine Zeit wahren Heldentums. Für uns heutige „Tastaturhelden“ hätten sie damals nur Verachtung übriggehabt. Das Vaterland leidet unter einer fremden Invasion? Na, dann aber drauf und dran bis man wieder Herr im eigenen Haus ist! Risiken? Not, Elend, Tod? Na, wenn schon! Die Begeisterung während der Befreiungskriege 1813-1815 brachte poetisch überhöhten Idealismus und reale Opferbereitschaft zusammen.
Theodor Körner war einer von ihnen. Obwohl seine eigentliche Berufung zwar die eines Dichters war, machte er aus Worten Taten und zog in den Kampf um Deutschlands Freiheit:
Hinter uns, im Grau´n der Nächte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevel fremder Knechte,
Der die deutsche Eiche brach.
Unsre Sprache war geschändet,
Unsre Tempel stürzten ein;
Unsre Ehre ist verpfändet:
Deutsche Brüder, löst sie ein!
Brüder, die Rache flammt! Reicht Euch die Hände,
Daß sich der Fluch der Himmlischen wende!
Löst das verlorene Palladium ein!
(„Bundeslied vor der Schlacht“, Auszug)
Ein riskantes, intensives Leben
Schon als Verbindungsstudent reizte Körner das Spiel mit dem Tod. Seine Mensuren brachten ihn oft in Lebensgefahr, einmal war es beinahe zu spät. Sein unruhiges junges Blut versetzte ihn in einen Lebens- und Todesrausch, der nur unzureichend durch seine Jugend und eine vor Überschuss berstende Kraft erklärt werden kann. In Universitätskreisen war Körner ein berühmt-berüchtigter Draufgänger, der froh sein durfte, dass ihn überhaupt noch eine Universität studieren ließ und er einen Abschluss erreichen konnte.
Wenn man das Schicksal ständig herausfordert, schlägt es bisweilen zurück. Körner wurde, nachdem er sich ungewöhnlich schnell und erfolgreich beruflich etabliert hatte, 1813 Kriegsfreiwilliger. Am 17. Juni erlitt er bei einem Gefecht bei Kitzen gegen die Franzosen eine schwere Verwundung. Nur mit knapper Not konnte er entkommen. Körner wusste seither aus eigener Anschauung um die von ihm eingegangenen Risiken, die noch größer waren, als bei seinen studentischen Duellen:
Gott laß mich nicht erliegen
In meiner Wunde Brand!
Laß nicht die Marter siegen –
´s war fürs Vaterland! –
Verlaß mich nicht, du Milde,
Der ich mich sonst bewußt,
Decke mit deinem Schilde
Die qualzerrissene Brust!
Der Kopf will mir zerspalten,
Wild glüht des Auges Kreis,
Doch meine Glieder kalten
Wie in des Nordens Eis.
Von mut´ger Qual zertreten
Der Geist im Staube schleicht.
Laß mich nur einmal beten,
Mein Gott, dann wird mir leicht!
Dein Gnad ist unverderblich! –
Mut, wenn das Herz auch reißt!
Der Leib, der Schmerz ist sterblich,
Unsterblich ist der Geist.
Gedicht „Als ich schwer verwundet lag im Augenblick des höchsten Schmerzes“
Guerillakrieg
Kaum ausgeheilt, konnte Theodor Körner nicht schnell genug wieder in den Krieg ziehen. Das „Lützowsche Freikorps“ lag am 27. August 1813 wieder einmal auf der Lauer, um die Truppen Napoleons aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wohl kaum eine jener Einheiten aus Freiwilligen hatte mehr Pathos und Draufgängertum, als das „Lützowsche Freikorps“. Da sie keine militärisch geschulte Einheit waren, mussten sie ihren Mangel an Ausbildung mit Mut und Todesverachtung wettmachen.
Gerade hatte man eine feindliche Nachschubkolonne mit infanteristischer Bedeckung gestellt. Es kam zu einem Kampf in bester Guerillatradition. Wer dachte in dem Augenblick an sich, an einen möglichen Tod? Der Feind musste vernichtet werden, koste es, was es wolle.
Wie im Rausch kämpfte Körner, ohne sich zu schonen. Er hatte regelrecht Angst, etwas im Befreiungskrieg zu versäumen. Wie hoch der Einsatz sein mußte, war ihm stets bewusst. Davon zeugt auch seine Dichtkunst. Wie einst Ikarus, wollte er seine Grenzen austesten.
„Lützows wilde Jagd“
Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein?
Hör’s näher und näher brausen.
Es zieht sich herunter in düsteren Reih’n,
Und gellende Hörner schallen darein
Und erfüllen die Seele mit Grausen.
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Was zieht dort rasch durch den finstern Wald
Und streift von Bergen zu Bergen?
Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt;
Das Hurra jauchzt und die Büchse knallt;
Es fallen die fränkischen Schergen.
Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Wo die Reben dort glühen, dort braust der Rhein,
Der Wütrich geborgen sich meinte;
Da naht es schnell mit Gewitterschein
Und wirft sich mit rüst’gen Armen hinein
Und springt ans Ufer der Feinde.
Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd.
Was braust dort im Tale die laute Schlacht,
Was schlagen die Schwerter zusammen?
Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht,
Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht
Und lodert in blutigen Flammen.
Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt:
Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd
Wer scheidet dort röchelnd vom Sonnenlicht,
Unter winselnde Feinde gebettet?
Es zuckt der Tod auf dem Angesicht;
Doch die wackern Herzen erzittern nicht.
Das Vaterland ist ja gerettet.
Und wenn ihr die schwarzen Gefall’nen fragt:
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.
Die wilde Jagd und die deutsche Jagd
Auf Henkersblut und Tyrannen!
Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt!
Das Land ist ja frei, und der Morgen tagt,
Wenn wir’s auch nur sterbend gewannen.
Und von Enkeln zu Enkeln sei’s nachgesagt:
Das war Lützows wilde, verwegene Jagd.
Körners letztes Gefecht
Diesmal wurde es tödlicher Ernst: Eine feindliche Kugel beendete am 26. August 1813 das junge Leben des Theodor Körner. Wahrscheinlich war es sogar ein Württemberger Deutscher in napoleonischem Zwangsdienst.
Körners Tod wurde ein Sinnbild deutschen Kampfgeistes. Schwert und Feder waren im Heldentod zu einer Einheit verschmolzen. Ein Dichtersoldat, der seine zu frühe Erfüllung fand:
Den Sieg verdankt man seinem Heldenmut,
Doch auch den Sieger zählt man zu den Leichen.
„Ström hin, mein Blut, so purpurrot!
Dich rächen meines Schwertes Hiebe;
Ich hielt den Schwur, treu bis in den Tod
Dem Vaterland und meiner Liebe
(„Treuer Tod“, Auszug)
Körners Tod schlug hohe Wellen. Das war der ideale Stoff für einen Mythos. So wurden die Todesumstände idealisiert und ausgeschmückt.
Ein kurzes, aber intensives Leben
Körner wurde am 23. September 1791 in eine gutsituierte bürgerliche Familie geboren. Im Haus seines Vaters verkehrten berühmte Männer, wie Goethe, Schiller, Kleist und Novalis. Von Kindesbeinen an erhielt er geistige Anregungen, die seine dichterischen Anlagen förderten. Vor jugendlicher Kraft strotzend, gesund an Geist und Körper, genoss er ein kurzes, risikoreiches Leben. Alle Möglichkeiten standen ihm offen. Was wäre aus ihm geworden, hätte ihm das Schreiben von Poesie gereicht? Wäre er in Ehren alt geworden, wie ein Goethe? Nein, Körner war von gewaltigen inneren Kräften getrieben, die das Höchste und Gewagteste um jeden Preis anstrebten:
Und sollt´ich einst im Siegesheimzug fehlen:
Weint nicht um mich, beneidet mir mein Glück!
Denn was, berauscht, die Leier vorgesungen,
Das hat des Schwertes freie Tat errungen.
(„Zueignung“, Auszug)
Seinem Vater schrieb er in einem Brief über seinen Entschluss, aktiv als Soldat in den Befreiungskampf einzugreifen:
Liebster Vater… Deutschland steht auf; der preußische Adler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung einer deutschen, wenigstens norddeutschen Freiheit…Ja lieber Vater, ich will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche und sorgenfreie Leben mit Freuden hinwerfen, um, sei´s auch mit meinem Blute, mir ein Vaterland zu erkämpfen…
(Auszug Brief vom 10.3.1813)
Verachtung für die Lauen
Im Befreiungskrieg standen Deutsche unter Napoleons Joch gegen Deutsche, die sich davon befreien wollten. Daneben gab es aber auch viele, die nur an sich und ihr Wohlergehen dachten. Während die Idealisten ihre Gesundheit, ihr Leben und ihr Hab und Gut aufs Spiel setzten, waren jene zu feige oder selbstsüchtig. Ihnen galt die volle Verachtung Körners. In seinem Gedicht „Männer und Buben“ hat er dies mit scharfer Zunge thematisiert (Auszug):
Das Volk steht auf, der Sturm bricht los;
Wer legt noch die Hände feig in den Schoß?
Pfui über dich Buben, hinter dem Ofen,
unter den Schranzen und unter den Zofen!
Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht;
Ein deutsches Mädchen küßt dich nicht,
Und deutsches Lied erfreut dich nicht.
Stoßt mit an,
Mann für Mann,
Wer den Flamberg schwingen kann!“„Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenrot,
Willkommen dann sel´ger Soldatentod! –
Du verkriechst dich in seidene Decken,
Winselnd vor der Vernichtung Schrecken.
Stirbt als ein ehrlos erbärmlicher Wicht;
Ein deutsches Mädchen beweint dich nicht,
Ein deutsches Lied besingt dich nicht,
Und deutsche Becher klingen dir nicht. –
Stoßt mit an,
Mann für Mann,
wer den Flamberg schwingen kann.
Dr. Joseph Goebbels hatte in seiner „Sportpalastrede“ 1943 daran angeknüpft und in ähnlichen Worten zum „Totalen Krieg“ aufgerufen: „Nun, Volk, steh auf, und Sturm, brich los!“. Im 1945 uraufgeführten Film „Kolberg“ wurde dies dann filmisch umgesetzt, doch es war im Gegensatz zu 1813-15 vergeblich. Der Zusammenbruch war nicht mehr aufzuhalten.
Ein einiges großdeutsches Vaterland
Und mögen sich noch Brüder trennen
Und sich in blut´gem Haß entzweien,
Und deutsche Fürsten es verkennen,
Daß ihre Kronen Schwestern sein,
Und daß, wenn Deutschland einig blieb,
Es einer Welt Gesetze schrieb: –
„Unsere Zuversicht“ (Auszug)
Wie selbstverständlich betrachtete Körner alle Deutschen als eine Schicksalsgemeinschaft. So betonte er immer wieder den deutschen Charakter Österreichs. Körner war zweifellos ein Großdeutscher. In dieser Zeit galt es jedoch zunächst das deutsche Land von Napoleons Besatzung zu befreien.
Das dichterische Werk
Das Werk Theodor Körners umfasst vor allem seine patriotische Gedichtsammlung „Leier und Schwert“ und zahlreiche weitere Gedichte, sowie etliche in seiner Zeit beliebte „Rätselspiele“, auch dramatische Werke, wie „Toni“, „Zriny“ oder „Der Kampf mit dem Drachen“ und einige Erzählungen.
„Zriny“
Das Trauerspiel „Zriny“ sticht unter Körners Dramen inhaltlich hervor. Es ist zeitlos aktuell. In dem dramatischen Fünfakter geht es um den Freiheitskampf eines Volkes gegen fremde Eroberer. Körner schrieb es 1812, als Deutschland unter dem napoleonischen Joch ächzte. Noch hatte die deutsche Erhebung gegen Napoleon nicht begonnen, sie zeichnete sich aber schon ab. Die Handlung wurde daher absichtlich nach Ungarn verlegt, das über Jahrhunderte gegen die Eroberung durch die Türken Widerstand für das Reich und ganz Europa leistete.
Also sprach Niklas Graf von Zriny:
Gemächlich mag der Wurm im Staube liegen,
Ein edles Herz muß kämpfen und wird siegen.
und
… das Unglück,
Das ist der Boden, wo das Edle reift,
Lorenz Juranitsch, ungarischer Hauptmann unter Zriny ergänzt:
Doch was man Leben nennt, die Spanne Zeit,
Die ich auf dieser Erdenwelt veratme,
Die ist des Vaterlandes Eigentum.
Kein Opfer ist zu viel fürs Vaterland
Das bei Körner immer wiederkehrende Motiv des Opfertodes für das Vaterland – auch in aussichtsloser Lage – findet im „Zriny“ seinen Höhepunkt: Das türkische Heer rückt mit 200.000 Mann Richtung Wien vor. Der deutsche Kaiser versammelt ein Ersatzheer, hat aber mit 80.000 noch nicht seine volle Stärke. In dieser Situation gilt es Zeit zu gewinnen. Der ungarische Graf von Zriny ist das letzte, allerdings winzige Bollwerk am Weg nach Wien. Zriny und seine zweitausend Getreuen verschanzen sich in Sigeth, einer kleinen Stadt mit einer Burg, um die Türken so lange aufzuhalten, wie irgend möglich.
Zriny:
Es gelte jetzt, fürs Vaterland zu sterben!
Ein großes Wort! – Du kennst mich Maximilian,
Ich danke für Dein kaiserlich Vertrauen.
Du kennst den Zriny, du betrügst dich nicht.
Nicht schönern Lohn verlangt´ ich meiner Treue,
Als für mein Volk und meinen ewigen Glauben
Ein freudig Opfer in den Tod zu gehen!
Der türkische Vormarsch stockt
Der Plan geht auf, der türkische Sultan, der das Heer persönlich anführt, verbeißt sich in die unerwartet schwierig zu erobernde Stadt. Nicht ganz überraschend stirbt der schon todkranke, alte Sultan, doch seine Heerführer führen die Eroberung trotz der mehr als 20.000 gefallenen Türken bis zum Sieg fort. Die letzte Bastion der Ungarn fällt. Zrinys Frau lässt den Pulverturm explodieren, nachdem die noch lebenden ungarischen Verteidiger bei einem finalen Ausfall den Tod im Kampf gesucht haben. Das große Opfer ist erfolgreich vollbracht. Die Ungarn fielen „für Freiheit, Ehre, Glauben, Vaterland“ (so Zriny in dem Drama). Die Türken zogen sich in ihr Reich zurück. Wien war gerettet.
Theodor Körner konnte damals nicht wissen, dass Wien rund 200 Jahre nach der Entstehung seines Dramas einer noch größeren, allerdings schleichenden tödlichen Bedrohung ausgesetzt sein würde. Auch nicht, dass es durch seine Bewohner kaum mehr verteidigt werden würde.
Fazit
Theodor Körner war ein begnadeter, nationaler deutscher Dichter. Körperlich und geistig fit, stellte er sich in einer dunklen Zeit der Unterjochung mit vollem Einsatz in den Dienst Deutschlands. Was er zuvor an Dichtkunst erschaffen hatte, lebte er schließlich vor. Im vollen Bewusstsein eines möglichen Todes im Kampf um die Freiheit schonte er sich nicht. Er suchte den Tod nicht, aber er akzeptierte ihn als einen annehmbaren Preis. Für das Deutsche Volk ist er Vorbild und Mahnung zugleich. In einer Zeit des drohenden endgültigen Niedergangs unseres Volkes sollte uns heute sein Opfertod erneut inspirieren, gegen Unterdrückung und Überfremdung aufzustehen.